80
In der der Potsdamer Garnisonkirche begegneten sich am Tag von Potsdam, dem 21. März 1933, Adolf Hitler, der neue Reichskanzler, und Reichspräsident von Hindenburg anläßlich der Eröffnung des Reichstages.[1] Die Machtergreifung der Nationalsozialisten habe durch diese Feier ihren symbolischen Abschluß erfahren, Preußentum und Nationalsozialismus seien im Rahmen eines schäbigen „Schmierenstücks“ eine unheilvolle Verbindung eingegangen. Das historische Argument wird durch die Forschung einhellig gestützt[2]. Der Tag von Potsdam wird als geschickte Inszenierung des Propagandaministers Goebbels herausgestellt, dessen Ziel es war, eine nationale Euphorie zu erzeugen und damit „Illusionen“ über den Charakter der NS-Bewegung zu wecken. Der Tag sei Zwischenstation auf dem Weg zum Ermächtigungsgesetz und damit zur Etablierung des Terrors gewesen. Konstatiert wird zwar die ungeheure Begeisterung, die in weiten Kreisen der Bevölkerung hervorgerufen wurde, doch hakt man diese lapidar als Resultat erfolgreicher Propaganda und Manipulation ab. Die funktionale Deutung wird folglich angereichert durch eine Argumentation, die das ganze Geschehen in Anlehnung an die Formulierung von Friedrich Meinecke als „Rührkomödie“ ideologiekritisch zu entlarven sucht[3]. In den einschlägigen historischen Untersuchungen gibt es jedoch einige Hinweise, die eine Spur sein könnten, jenseits aller berechtigten Abscheu über die Verherrlichung von Militarismus, Diktatur und Unrecht dem Erfolg der Inszenierung auf den Grund zu gehen. Begrifflichkeiten wie „Weihe“ und „Fest der nationalen Wiedererweckung“ verweisen darauf, daß offensichtlich am Tag von Potsdam im Gegensatz zu heute gänzlich anders gelagerte mentale Tiefendimensionen, Glaubensvorstellungen und nationale Deutungsmuster ihren Ausdruck fanden. Der Historiker Kershaw sieht denn auch im Tag von Potsdam ein wichtiges Ereignis, das das Charisma des neuen Reichskanzlers über seine eigentliche Anhängerschaft hinaus erhöhte. Der „überdimensionale Nimbus des Führers wurde nicht nur künstlich von der Propaganda geschaffen, sondern war im hohen Maße ein gesellschaftliches Produkt, erzeugt von den Führer-Erwartungen, Ressentiments und Sehnsüchten breiter Volksschichten“[4]. Die Erzeugung solcher außeralltäglichen Eigenschaften stand, so meine von der Weberschen Herrschaftssoziologie angeregte Ausgangshypothese, in engstem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Feier in Potsdam durchgeführt wurde und welche Konnotationen sich mit dem Ort für die Zeitgenossen verbanden. So ist in der bisherigen Betrachtung die religiöse Dimension vernachlässigt worden: Die Feierlichkeiten fanden in drei Kirchen Potsdams statt, die Inszenierung enthielt religiöses Liedgut, Predigt und kirchliche Liturgie[5]. Demzufolge stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von historischer Erinnerung, politischer Herrschaft und von religiösen Überzeugungen in Verbindung mit der Rolle der Kirchen. Ihr liegt die Prämisse zugrunde, daß charismatische Herrschaft durch religiöse Handlungen eine Begründung findet. Die geschichtsmächtige Kraft religiöser Vorstellungen zeitigt Wirkung, solange Ritual und Inhalte der Glaubensüberzeugungen konform gehen, das Ritual also nicht, wie unlängst in Potsdam zu sehen, inhaltsleer ist.
Die Religionssoziologie faßt Religion als Beziehung zu übersinnlichen Gewalten auf, die sich in Bitte, Dank und Opfer sowie Gotteslob (Doxologie) äußert und sich in gemeinschaftlich vollzogenen, geregelten Ritualen (Liturgie) und in individueller Verehrung vollzieht[6]. Die Rituale bedürfen der Normierung, des Kultortes, der Kultgeräte und des symbolischen Ausdrucks. Damit ist die Kirche angesprochen: Sie ist gekennzeichnet durch anstaltliche Merkmale, d. h. durch schriftliche Satzungen, ein System der Lehre, eine Priesterschaft und vorgeschriebene gottesdienstliche Ordnung. Jede Kirche zeichnet das Bestreben aus, die ausschließliche Deutung der göttlichen Offenbarung vorzunehmen und exklusiv für die Angehörigen der Anstaltskirche göttliche Hilfe (Heil) zu sichern und zu spenden (extra ecclesiam nulla salus)[7]. Eine so verstandene Kirche ist, wie Ernst Troeltsch ausführt, als Wunderkirche zu verstehen, denn sie verwaltet die von Christus hergeleitete „Gnaden- und Wunderkraft“. Dabei ist es gleichgültig, ob diese im Sakrament katholischer Prägung oder in der Wunderwirkung der Verkündigung des göttlichen Wortes protestantischerseits gespendet wird[8].
Für den Tag von Potsdam ergibt sich also die Frage, ob hier kirchliches Heil und damit göttliche Hilfe den Mächtigen zuteil wurde. Die skizzierte Definition von Religion macht auch den Zugriff auf die mentale Tiefendimension in Verbindung mit der Wahrnehmung von Geschichte leichter: Geht man von der Überlegung aus, daß sich einerseits im Prozeß der Säkularisierung der religiöse Verweis auf die Endzeit wandelt zu einem Ziel innerhalb der Welt[9], andererseits Geschichte über die Zwischenstation Mythos religiöse Züge annimmt, zur Heilsgeschichte wird[10], so kann gefragt werden, ob im Verein mit der kirchlich verkündeten Offenbarung oder separat dazu religiöse Deutungen des politischen Handelns in Vergangenheit und Gegenwart die Vorstellungswelt der Zeitgenossen beeinflußten.
Die Analyse bietet somit die Möglichkeit, den „heiligen Schauer“ (Thomas Sandkühler), der die Akteure erfaßte, in allen Facetten nachzuzeichnen. Damit ist der Problemkreis angesprochen, den ich eher vage mit dem Begriff ‚mentale Tiefendimensionen‘ umschrieben habe. Darunter sind jene unbewußten, handlungsleitenden und Wahrnehmung konstituierenden Dispositionen zu verstehen, die sich speisen aus anthropologischen Grundbedürfnissen nach Vergegenwärtigung und Sicherstellung des Heiligen und aus den menschlichen Versuchen, göttliche Hilfestellungen zu erlangen. Im ersten Teil des Aufsatzes werden die Glaubensüberzeugung der Kirche und die nationalen Mythen in ihrer religiösen Aufladung herausgearbeitet. Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit dem feierlichen Ritual in Potsdam. Der abschließende Teil versucht am Beispiel protestantischer und katholischer Städte und Dörfer Westfalens, die Breitenwirksamkeit des Tages von Potsdam nachzuzeichnen. Auf diese Weise wird geprüft, ob die in den ersten Kapiteln skizzierten Vorstellungswelten diejenigen einer abgehobenen Gruppe kirchlicher Funktionäre und politischer Handlungsträger waren oder ob nicht ähnliche Dispositionen und Deutungen in der Provinz vorhanden waren, die die Inszenierung des Tages von Potsdam erst zum Erfolg werden ließen und damit langfristig die Herrschaft des Nationalsozialismus religiös legitimierten.

I. Die Kulisse und die Beteiligten
1. Potsdam als Wallfahrtsort der Nation[11]
Die Stadt Potsdam war mit ihren Kirchen der Inbegriff der besonders engen Verbindung protestantischer Kirchlichkeit mit der preußischen Staatsidee. Friedrich Wilhelm I. hatte die 1735 vollendete Garnisonkirche als Ort des Gottesdienstes für seine Soldaten und als Grablege für sich errichten lassen (Abb. 1). 1786 Fand in Mißachtung seines Testamentes Friedrich II. in der Gruft der Kirche neben seinem Vater seine vorerst letzte Ruhestätte. Im Laufe der Zeit trat die Funktion als Gotteshaus der Potsdamer Garnison zurück zugunsten einer Kirche des Herrscherhauses. Die Hohenzollern ließen sich von den protestantisch-preußischen Hofpredigern das Wort Gottes in der Predigt auslegen und empfingen das Abendmahl. In der Architektur und Ausstattung der Kirche spiegelt sich die Herrscherzentriertheit wider: Der Ort, an dem sich gemäß dem protestantischen Selbstverständnis göttliche Gnade manifestiert, die marmorne Kanzel stand der auf derselben erhöhten Ebene befindlichen Königsloge gegenüber; schräg darunter, im Kirchenschiff, befand sich der Altar. Im Gegensatz zu der kargen Ausstattung vieler anderer protestantischen Kirchen fiel dem damaligen Betrachter der reiche Schmuck auf. Doch statt der Darstellung biblischer Geschehnisse war das Bildprogramm der Garnisonskirche eine Vergegenwärtigung von Preußens Gloria: Während katholische Kanzeln die Abbildungen der vier Evangelisten zeigen, verherrlichte die Potsdamer Kanzel den Krieg. Auf dem Sockel der Marmorkanzel waren Panzer, Waffen und Trompeten zu sehen, an den Pfeilern rechts und links der Kanzel Fahnen und Standarten des ehemaligen preußischen Regiments Gardeducorps. Seitlich der Kanzel erinnerten in einer Nische die Wappen von Preußen, Rußland und Österreich an das Bündnis gegen Napoleon, sie mahnten an den Wiederaufstieg Preußens nach einer Zeit der „Erniedrigung“. Über dem Schalldeckel war das Symbol göttlicher Gegenwart, das Dreieck mit dem Auge Gottes, zu sehen, darunter das Sinnbild Preußens, der mit Krone, Zepter und Apfel geschmückte Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Die Ausstattung verdeutlichte folglich die Hilfe Gottes in der preußischen Geschichte. Gleiches für Fahnen und Standarten, die man in den Befreiungskriegen und den Reichseinigungskriegen den gegnerischen Truppen abgenommen hatte. Auch dem Sterben in den Kriegen wurde in der Garnisonskirche sind verliehen: Gedächtnistafeln für die gefallenen der Kriege 1805/06 / 1813-1815 / 1806 4/66/70/71 / 1914-1918 waren angebracht.
In der Zeit von 1735-1933 stand die Garnisonkirche folglich nicht allein für einen Protestantismus der „reinen Lehre“, sondern für den preußischen Weg des Protestantismus in seiner Einbeziehung des Staates als Objekt kirchlichen Heils. Doch ist dies nur die eine Dimension, die die Garnisonkirche auszeichnete. Einzigartig unter allen Kirchen in Preußen war sie aufgrund ihrer besonderen Heiligkeit. Die preußischen Herrscher als oberste Bischöfe der Kirche (summus episcopus) besuchten diesen Ort auch deshalb[12], weil er die Grablege ihrer Vorfahren war. Hier verweilten sie im Gedenken, sie waren Pilger, da sie einen Gang zu einer herausgehobenen heiligen Stätte unternahmen, deren Kultobjekt die sterblichen Überreste der beiden Könige war. Diese besondere Funktion der Kirche wird in der baulichen Ausgestaltung deutlich: Nach der Fertigstellung der Kirche 1735 fanden 1737 auch die Bauarbeiten an der Krypta (Gruft) der Kirche ihren Abschluß. Die Kanzel der Garnisonkirche als Ort der Verkündung des göttlichen Wortes stand nicht isoliert dar, sondern war architektonisch mit der Gruftkammer zum „Königlichen Monument“ vereinigt.

Das 1842 entstandene Bild (Abb. 2) von Adolph Menzel zeigt uns diesen Zusammenhang. Das Ensemble bestand also aus Gruft, darüber, direkt anknüpfend, die Kanzel und in luftiger Höhe die Orgel — die Gruft erhöhte die Heilswirkung des Ortes bzw. fundierte sie erst. Dies wird auch daran deutlich, daß die Prediger, wollten sie die Kanzel besteigen, eine Treppe benutzen mußten, die über die Decke der Gruft zur Kanzel führte.
Dieses Pendant zur katholischen Praxis, Altäre als Orte des eucharistischen Mysteriums mit Reliquien auszustatten, verweist darauf, daß mit den Leichnamen der beiden Könige Deutungen verbunden waren, die nicht in Einklang mit der protestantischen Lehre standen. Ließen die Reformatoren Heilige nur als Vorbilder für ein gottgefälliges Leben zu und verwarfen den Kult um Reliquien völlig, so scheint die Hervorhebung der Gruft dafür zu sprechen, daß sie eine besondere Aura barg. Nicht als katholische Heilige, die im Jenseits Fürbitte bei Gott einlegen, doch immerhin als transzendente Wesen, die über ihr irdisches Leben hinaus erfahrbar sind, so wurden die Könige im „Monument“ aus der Vergangenheit in die Gegenwart projiziert. Daß diese aus der Ausstattung der Kirche gewonnene Interpretation tatsächlich den Wahrnehmungshorizonten der Zeitgenossen bis 1933 entsprach, soll im weiteren geklärt werden. Offen ist auch die Frage geblieben, auf welche Art und Weise die beiden Hohenzollern in den Glaubensüberzeugungen der Zeitgenossen verwurzelt waren.
Der Begriff „Realpräsenz“ (Peter Dinzelbacher) aus den Untersuchungen zur mittelalterlichen Volksfrömmigkeit[13] trifft m. E. den Sachverhalt in etwa: am Ort ihrer Leiber waren Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. den frommen Pilgern gegenwärtig und erschienen kommunikationsfähig. Diese Vorstellung speiste sich aus verschiedenen Quellen: Zum einen ist die Ausstattung der Kirche hervorzuheben. Die Kirche war angefüllt mit Erinnerungen an die beiden Könige. Es handelte sich um Stiftungen, beispielsweise liturgische Geräte, die Fahnen ihrer Regimenter, die Inschriften an verschiedenen Stellen der Kirche und am Eingang. Die Verherrlichung fand ihren Gipfelpunkt auf der Spitze des 88 Meter hohen Turmes. Dort war das Sinnbild des Preußentums, der zur Sonne fliegende Adler, mit dem Namenszuge Friedrich Wilhelm I. zu sehen. Damit wurde wiederum an das Programm von Kanzel und Gruft angeknüpft. Auch ‚Sekundärreliquien‘ anderer herausragender Persönlichkeiten preußischer Geschichte zeugten von der besonderen Aura, die man bestimmten Hohenzollern zuwies. Zu erinnern ist hier insbesondere an den in der Familienloge befindlichen Stuhl der Königin Luise, der Ehefrau König Friedrich Wilhelms III. Die Königin, in der Literatur als „preußische Madonna“ bezeichnet[14], repräsentierte ebenfalls das Ineinandergehen von Mythos und Religion. Sie habe durch ihr inständiges Bitten bei Napoleon 1807 in Tilsit den preußischen Staat gerettet, doch sei es ihr nicht vergönnt gewesen, die Befreiung Preußens zu erleben: Sie starb 1810 im blühenden Alter von 34 Jahren.
In allen Stadtführern Potsdams und den zeitgenössischen Darstellungen zur Geschichte Preußens sowie in Bildern wird die Wallfahrt berühmter Persönlichkeiten zu den Gräbern tradiert. Sie verrichteten ihre Andacht oder kamen zu entscheidenden politischen Gesprächen zusammen. Insofern tun sich hier Ähnlichkeiten mit den Reichsheiligtümern katholischer Prägung auf, wie Altötting für die Wittelsbacher und Mariazell für die Habsburger. Im Zentrum stand dabei nicht der bigotte Friedrich Wilhelm, sondern Friedrich der Große, zu Lebzeiten ein Freigeist.

1805 trafen sich Friedrich Wilhelm III., die Königin Luise und Zar Alexander I. in der Gruft, um das preußisch-russische Bündnis gegen Napoleon zu bekräftigen, das sich dann in den „Befreiungskriegen“ bewährte (Abb. 3). Immer wieder nacherzählt wurde auch der Besuch des Kaisers Napoleon 1806. Der Kaiser betrat in Begleitung seines Bruders Jerome die Gruft, um „in tiefer Betrachtung an dem Sarge des großen Königs“ zu verweilen. „Sic transit gloria mundi“ habe er dann nach einer Weile der Nachdenklichkeit gesagt. Die besondere Aura machte, so die Logik der Erzählung, Eindruck auf den Eroberer, denn er befahl, die Garnisonkirche nicht wie die anderen Kirchen der Stadt militärisch zu nutzen, sie also nicht zu profanisieren. Kann man nun schließen, daß der König zum preußischen „Pantheon“ gehörte? Dies würde bedeuten, daß er in der Lage gewesen wäre, ins Diesseits machtvoll einzugreifen. Eine solche Interpretation der Vorstellungswelten geht jedoch zu weit. Verbunden wurde seine Anwesenheit mit einem Gott, der als machtvoller Gott verstanden wurde. Das „königliche Monument“, Gruft mit der Kanzel, beleuchtet diesen Aspekt; die Allmacht Gottes, an der Spitze der Kanzel dargestellt, war die Grundlage. Diese auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinende Deutung kann mit den bis 1933 massenhaft verbreiteten Beschreibungen der Leben und Taten von Friedrich II. belegt werden[15]. In den „Heiligenviten“ spiegeln sich herausragende Tugenden, die einen heiligmäßigen Rang zuwiesen, aber auch den Aufstieg des preußischen Staates mit sich brachten. An entscheidenden Stellen des Lebens ist es Gott, der Hilfe in der Bedrängnis leistet. Im Gegensatz zum protestantischen Verständnis der Rechtfertigung half Gott Friedrich und der Nation auch deshalb, weil Fleiß, Tapferkeit und Disziplin beherzigt wurden.
Diese enge Verbindung zwischen der in der Vita begründeten Überhöhung preußischer Tugenden zu heiligmachenden Eigenschaften und der den Preußenkönig mit seiner Gnade ausstattenden Person Gottes wird auch in dem in allen Beschreibungen herausgehobenen Glockenspiel der Garnisonkirche deutlich. Seit 1797 spielte der vierzigstimmige Glockenchor zur vollen Stunde „Lobe den Herren“, zur halben Stunde „Üb‘ immer Treu und Redlichkeit“.
Eine zentrale Begegnung von Gott und tugendhaftem Herrscher war für die Zeitgenossen die Schlacht von Leuthen 1757, der kriegsentscheidende Bedeutung zugemessen wurde, weil die preußische Armee die weit überlegenen Österreichischen Regimenter niederrang. Der König begann die Schlacht, so ein vielfach wiedergegebener Bericht, mit den Worten: „Nun Kinder, frisch heran in Gottes Namen!“. Nach dem Sieg habe ein alter General dem König seine Gratulation abgestattet. Dieser erwiderte: „Das, das hat ein Höherer getan!“. Und seine Soldaten dachten ebenso, als sie den alten evangelischen Choral „Nun danket alle Gott“ anstimmten, der hiernach als Choral von Leuthen in der protestantisch-preußischen Liturgie seinen Einzug hielt[16]. Wer dermaßen dem Schicksal eine Wende geben konnte, mußte mit Gott im Bunde sein. Konsequenterweise erhielten die Mythen auch eine religiöse Komponente, als das Sterben des Königs beschrieben wurde: Der Agnostiker Friedrich II. starb, so der Neuruppiner Bilderbogen von 1882, nicht allein, sondern im Kreis seiner Vertrauten: „Heiterer Friede, Sieg und Versöhnung ruhten auf der Stirn des Verklärten“[17]. Auf vielfältige Weise legitimiert durch die göttliche Hilfe schon in ihrem Leben, waren die Könige auch später noch, vor allem Friedrich II, Bindeglieder zwischen Diesseits und Jenseits: in Potsdam als Reliquien gegenwärtig und in den Mythen, die religiöse Züge enthielten, am Leben erhalten, verortet auch im Jenseits bei einem Gott, der seine Hand schützend über Preußen legte und diesen Staat dazu berief, das neue deutsche Reich zu errichten. Dermaßen nicht der unbegreiflichen göttlichen Entscheidung ausgeliefert, wie sie gerade der Calvinismus verkündete — und die Hohenzollern waren Calvinisten —, erwuchs der Mythos Friedrich zum Ausdruck für das Bedürfnis der Menschen nach Heilsgewißheit.
In der Weimarer Republik wurden die Preußenkönige, und insbesondere Friedrich II, von nationalistisch-monarchistischen Kreisen genutzt, um gegen vermeintliche Mißstände anzugehen, gleichzeitig war vor allem der große König für diese Gruppen Hoffnungsträger, der eine bessere Zukunft verhieß. Plakate mit dem Bild des Königs warben dafür, das Volksbegehren für die Auflösung des preußischen Landtages zu unterstützen. Friedrich II. zerschlug die Bastion der Sozialdemokratie[18]. In den Filmen wurde der preußische Nationalheilige Friedrich gefeiert, sein Leben nachgespielt mit all den vielen wunderbaren Wandlungen[19]. Auch erlebte die Garnisonkirche eine bedeutende Aufwertung, indem sie einer umfangreichen Restaurierung unterzogen wurde und zum Mekka der nationalistisch-monarchistischen Kreise aufstieg. Wie aktuell die Verehrung in breiten bürgerlichen Kreisen blieb, zeigt das Beispiel der Kriegervereine. Die Mitglieder rechneten es sich als besondere Ehre an, für ihre Feierlichkeiten den berühmten Friedrich-Darsteller Otto Gebühr einzuladen, um auf diese Weise des großen Preußenkönigs Teilnahme anzudeuten[20].
Historische Sachverhalte erlangten eine Anbindung an die Göttlichkeit. Dieses Gottesverständnis jedoch löste sich von dem Bild der Reformatoren. Dieser Aspekt soll im folgenden weiter ausgeführt werden, um die Stellung der Kirchen verstehen zu können.
2. Die Kirchen
Weite Kreise des Protestantismus hatten die christliche Eschatologie mit einer nationalen Heilslehre vermengt, die in einem Deutschen Reich protestantisch-preußischer Prägung den erhofften Endzustand sah. Eine wichtige Rolle in dieser Endzeitperspektive bildete dabei die Vorstellung vom „Volksnomos“: die Einigung des ganzen deutschen Volkes in Gläubigkeit. Der Gott, dem die Mehrzahl der Theologen am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts huldigte, war ein Gott, der sein besonderes Augenmerk auf das deutsche Volk gerichtet hatte[21]. Dieses war herausgehoben, denn im geschichtlichen Prozeß, insbesondere in der Reichseinigung, später auch am Beginn des Krieges 1914, zeigte sich die besondere Hilfestellung Gottes.[22]
Die Kirche reservierte und spendete göttliche Gnade exklusiv für Volk und Staat, dabei tolerierend, daß sich neben den reformatorischen Leitsätzen auch eine eigenständige Frömmigkeit bilden konnte, die auch die Kirche erfaßte. An der Garnisonkirche kann man die Akzeptanz außerkirchlicher Deutungsmuster wahrnehmen: Hier trafen die protestantischen Hofprediger ihren obersten Bischof bzw. Dienstherren und legten ihm die Schrift aus, spendeten göttliche Gnaden gemäß der Vorstellung von „sola scriptura‘“. Gleichzeitig betreute man den Wallfahrtsort der Nation, erlag dem Kult um Friedrich den Großen und seinen Vater und minderte dadurch die Vorstellung von der Einzigartigkeit Gottes, indem man heiligenähnliche Gestalten in seine Nähe rückte. Mit der Niederlage 1918 brach für viele Kirchenvertreter eine Welt zusammen. Es begann eine Zeit der Leiden. Die Mehrzahl der protestantischen Pfarrer huldigte weiter einem Pastorennationalismus, eine „Krisenmentalität“[23] äußerte sich in der Wahrnehmung von Atheismus, Liberalismus und Bolschewismus sowie in dem Klagelied über den Verlust preußisch-protestantischer Tugenden wie Disziplin, Fleiß und Ordnung.
Die Zeit der Prüfung und Leiden hatte für die katholische Kirche im Deutschen Reich früher angefangen, von daher huldigte sie nicht einer wie auch immer gearteten eschatologischen Nationalperspektive. Auch der Kult um die Könige gewann im katholischen Bereich keine Anhänger, da die Auseinandersetzung mit dem Preußentum in den „Kölner Wirren“ und dem Kulturkampf traumatische Wirkungen gezeitigt hatte. Der Gott der Katholiken war, wenn man so will, ein übernationaler Gott, zumindest für die politische Führung der Katholiken und für den Klerus. Der Wunsch nach Integration, der seinen lebhaftesten Ausdruck in der Kriegsbegeisterung 1914 fand, war in der Weimarer Republik nach wie vor virulent. Auf der einen Seite arbeitete der politische Katholizismus entscheidend mit am Aufbau der Demokratie, auf der anderen Seite sahen die Katholiken in dieser Zeit einen verhängnisvollen Niedergang christlicher Deutungsmuster und kirchlicher Reichweite[24].
II. Das Ritual
Die Inszenierung[25]
Die Initiative, die Wiedereröffnung des Deutschen Reichstages in Potsdam durchzuführen, kam vom neuen Propagandaminister Joseph Goebbels, dessen Absicht es war, eine Feier zu veranstalten, die sich „unverlöschlich‘“ im Gedächtnis der Menschen festsetzt. Diesem Zweck diente zunächst der Termin: der 21. März war der Tag, an dem der deutsche Reichtstag des Kaiserreiches 1871 erstmals zusammentrat. Der auserkorene Ort verband folglich das Kaiserreich preußischer Prägung mit der Jetztzeit. Der „Tag der nationalen Erhebung“ hatte auch im Jahresablauf eine wichtige Stellung, er war gleichzeitig Frühlingsanfang. Goebbels setzte alles daran, das Ereignis reichsweit verbreiten zu lassen. Den noch existierenden Zeitungen wurde seitens der Reichsregierung empfohlen, einen Aufruf des Propagandaministers zu veröffentlichen. Darin heißt es: Die Feier in Potsdam demonstriere den nationalen Wiederaufstieg nach Zeiten der „Schmach und Demütigung“. Potsdam sei der Ort eines „unsterblichen Preußentums“, die Garnisonkirche die „geschichtlich geweihte Ruhestätte unserer großen preußischen Könige‘. Potsdam als Weihestätte ist für Goebbels also der Garant für den nationalen Wiederaufstieg. Insofern enthält das Motto des Tages auch religiöse Beschwörung: „Nimmer wird das Reich zerstöret, wenn Ihr einig seid und treu“. Goebbels steuerte die mediengerechte Verbreitung des Ereignisses: Alle deutschen Sender waren von dem neuen Propagandaminister angewiesen worden, ein einheitliches Programm zu senden. Lifeschaltungen aus Potsdam wechselten sich mit preußischen Märschen und historischen Vorträgen ab. Abends folgte eine Übertragung der Festvorstellung der Berliner Staatsoper mit Wagners „Die Meistersinger“.
Aus der Nichterwähnung der Kirchen darf jedoch nicht geschlossen werden, daß diese bei der Inszenierung ausgeblendet blieben. Sie waren vielmehr in die Vorbereitungen einbezogen worden und entwickelten ihre Vorstellungen sowohl was die liturgische Ausgestaltung als auch die Inhalte der Predigten angeht. Zwar lehnte die Spitze der evangelischen preußischen Kirchenleitung das Ansinnen der neuen Reichsregierung ab, die Garnisonkirche als neuen Sitz des Reichstags zur Verfügung zu stellen, doch gegen eine Eröffnungsfeier erhob sie keine Einwände. Auch die Glocken aller Potsdamer Kirchen, so die kirchliche Entscheidung, konnten den geplanten „Staatsakt“ einläuten[26]. Der evangelische Festgottesdienst sollte in der Potsdamer Nicolaikirche stattfinden, einem der berühmtesten Bauwerke Schinkels. Das Bildprogramm der Kirche zeigt zentrale Aussagen der evangelischen Glaubenslehre und Bildnisse von Kirchenvätern sowie von Reformatoren. In der Ausstattung lassen sich u. a. auch Stiftungen der Hohenzollern nachweisen[27]. Die Gemeindevertreter hatten sich angeboten, Ordner für den Festgottesdienst zu stellen. Der Superintendent Görnandt und der Pfarrer der Nicolaikirche, Lahr, organisierten die Ausschmückung. Der für Potsdam zuständige Generalsuperintendent der Kurmark, Otto Dibelius, arbeitete an einer Predigt und überhörte bei dieser Gelegenheit die Warnungen des Theologieprofessors Karl Barth[28].
Auch die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul hatte entsprechende Vorbereitungen getroffen, der geistliche Nuntius, Botschafter des Papstes, war eingeladen worden, die Meßfeier selbst sollte von einem Vertreter des Berliner Bischofs zelebriert werden.
2. Die Feier in der Nicolaikirche
Die evangelischen Mitglieder der Reichsregierung, die Mitglieder des Staatsrates und die evangelischen Abgeordneten wurden von den Gemeindevertretern in das Kirchenschiff geleitet; im Altarraum fanden Vertreter der Stadt Potsdam und die örtliche Geistlichkeit Platz. Kurz vor 10.30 Uhr, dem Beginn des Gottesdienstes, traf Hindenburg ein. In seinem Empfang spiegelt sich nicht nur die Wertschätzung für den Vertreter der weltlichen Obrigkeit wider, vielmehr auch die Unterordnung gegenüber der „geistigen‘“ Führung der Kirchen der Altpreußischen Union in der Tradition des landesherrlichen Kirchenregiments und Staatskirchentums (Abb. 4a u. b). Der Hausherr, Pfarrer Lahr, hatte sein Töchterchen beauftragt, dem greisen Präsidenten einen Blumenstrauß zu überreichen. Anschließend begrüßten Generalsuperintendent Dibelius und Superintendent Görnandt den mit seiner Generalfeldmarschalluniform bekleideten Reichspräsidenten ehrerbietig. Die Gruppe betrat die Kirche, Hindenburg wurde zu seinem am Fuß des Altars befindlichen Sessel geleitet; der Gottesdienst konnte beginnen.


Die ihm zwar nicht formal untergebenen, doch ihn als „Ersatzkaiser‘“ und „-bischof‘““ schätzenden geistlichen Würdenträger standen somit in derselben Situation wie einstmals die Hofprediger des Kaiserreiches: In der Nicolaikirche fand ein Gottesdienst statt, in dem evangelische Pfarrer den Regierenden das Wort Gottes auslegten und göttliche Gnade herabflehen. Die Feier war jedoch auch Gottesdienst der Gemeinde, deren Mitwirkung sich nicht allein im Zuhören erschöpfte, sondern sich in Lied und Gebet ausdrückte. In der Eingangsliturgie wurde zunächst das Lob Gottes ausgesprochen, dann in Anknüpfung an den vom Superintendenten Görnandt vorgetragenen Psalm 46 („Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“) das Vertrauen auf die göttliche Gnade von der Gemeinde zum Ausdruck gebracht, die eines der zentralen Lieder des Protestantismus, „Ein‘ feste Burg ist unser Gott“, sang: „Er hilft frei uns aus aller Not, die jetzt uns hat betroffen“. Das Vertrauen auf Gott in der Zeit der Bedrängnis durchzog auch die Lesung. Görnandt zitierte aus dem Epheserbrief, in dem Paulus vor den Herren der Finsternis warnt. Vor ihnen schütze Wahrheit, Gerechtigkeit und der Glauben, der das Wort Gottes sei. Der zu lobende Gott, der die Gegenwart ertragen hilft und sie als Zeit der Prüfung dem Menschen auferlegt, war für den Superintendenten auch derjenige, der für die Wende zum Besseren verantwortlich zeichnet! Dies entspreche seinem göttlichen Willen und sei Ausdruck seiner Annahme des sündigen Menschengeschlechtes.
Der ordinierte Prediger, hier Otto Dibelius, wußte die Offenbarung in die richtigen Zusammenhänge zu stellen. Dibelius hat die göttliche Hilfe erkannt. Schon im Vorfeld äußerte er seine Zustimmung zu dem neuen Aufbruch in Deutschland, wenn er auch die Kirche aus dem Bereich der Politik heraushalten wollte. Und doch waren die Anknüpfungen an zentrale Ereignisse der deutschen Geschichte nicht zu überhören, da Dibelius über dieselbe Stelle des Römerbriefes predigte, die schon der Hofprediger Dryander bei der Eröffnung des Deutschen Reichstages am 4. August 1914 anläßlich des Kriegsbeginnes ausgelegt hatte: „Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein“.
Erneut ist es eine Umbruchsituation, in der sich göttliches Wirken offenbart. War es 1914 der Krieg, der von protestantischen Theologen als Zeit christlicher Bewährung gesehen wurde, so ist für Dibelius 1933 die Zeit des Niederganges beendet, die die Einheit des gläubigen Volkes zerstört habe. Schuld an dieser Trennung seien „Klassenhaß und Parteizerklüftung‘“ gewesen. Der Neubeginn der politischen Geschichte ist zeitgleich mit dem Neuanfang der Kirche anzusetzen, denn politischer Wandel und eine erneute Hinwendung des Volkes zum Glauben bedingen sich, so der Prediger. Gottes unbegreifliche Gnade zeige sich allen Menschen, doch die Losung „Mit Gott zu neuer Zukunft“ läßt Dibelius exklusiv für das deutsche Volk gelten. Denn während in Rußland der Bolschewismus herrsche und in den Wolkenkratzern New Yorks der Materialismus, eröffnet sich dem deutschen Volk nach einer Zeit des Niederganges, in der es nur noch den „mechanisierten Menschen gab“, eine Zukunftsperspektive, in der „durch Gottes Gnade ein deutsches Volk“ im Entstehen begriffen sei. Dieser religiöse und völkische Einigungsprozeß werde auf der einen Seite von einer missionarischen Kirche, die das Wort Gottes in rechter Weise verkündet, geleitet, zum anderen durch den Staat. Darum habe der Staat gegen diejenigen vorzugehen, die „die Grundlage der staatlichen Ordnung untergraben, die die Ehe zerstören, den Glauben verächtlich machen und den Tod für das Vaterland begeifern“. Nach einer Phase, in der sich diese neue Ordnung durchsetze, müsse jedoch zu Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt werden.
Diese Rechtfertigung staatlicher Gewalt gegenüber Andersdenkenden wird in der Literatur zu Recht betont. Unberücksichtigt bleibt, daß die Unterstützung der neuen Machthaber nicht in der Autoritätshörigkeit der Protestanten und ihrem „Quietismus‘“ ihre zentrale Begründung fand. Dieses Argument ist insofern unberechtigt, als sich Dibelius eine optimistische Sichtweise des lutherischen Verständnisses zum Verhältnis von Welt und Kirche angeeignet hat. Für Dibelius bekommt die Zwei-Reiche-Lehre Luthers eine neue, unerwartet positive Wendung[29]. Während für den Reformator, beispielsweise in der Fürstenpredigt[30], die weltliche Obrigkeit keine christlichen Ideale verwirklicht und dies, selbst wenn sie guten Willens wäre, wegen der Boshaftigkeit vieler Menschen auch gar nicht kann, und sich der isolierte Christ folglich nur im Leiden der unchristlichen Obrigkeit unterwerfen kann, zeichnet sich für Dibelius mit dem Tag von Potsdam eine neue Entwicklung ab: Der Christ kann, so meine Interpretation der Predigt, freudig der Obrigkeit untertan sein, denn diese führt ein evangeliumsgemäßes Regiment in der Welt und verwirklicht dadurch die Gebote der Bergpredigt. Bedingung ist die Ergriffenheit aller, Herrscher und Beherrschte, vom Geist Christi durch Gottes Gnade, denn sie erzeuge ein „geheiligtes Volk“. Dies ist eine einzigartige geschichtstheologische Wendung: „Gott handelt! Er handelt in der Geschichte. Er handelt in jedem Menschenleben. Er ist persönlicher Gott — für uns!“ Gerade um die zwei Reiche miteinander zu versöhnen, erscheint es Dibelius notwendig, staatliche Gewaltanwendung als Grundlage eines Neuanfangs, in dem Volk und Obrigkeit einen christlichen Weg einschlagen, zu rechtfertigen. Dermaßen von dem Eingriff Gottes im Diesseits überzeugt, kann Dibelius den göttlichen Segen auf das Werk der Regierung, der christlichen Obrigkeit und auf die Christen in und unter dieser Obrigkeit herabflehen: „Das ist heute unser Gebet: daß Gottes Gnadenhand über dem Bau des Deutschen Reiches die Kuppel wölbe, die einem deutschen, einem geheiligten, einem freien Volk den Blick für immer nach oben zieht, Deutschland wieder und für immer: Ein Reich, ein Volk, ein Gott!“
Nimmt man die Formulierung Troeltsch’ von der Wunderkirche auf, so äußert sich in der Predigt die feste Überzeugung, die Kirche könne durch ihr Wirken das göttliche Wunder verstetigen. Demzufolge enthielten auch die Fürbitten nochmals die Überzeugung, daß der mit der Reichstagseröffnung begonnene Wandel auch hinfort mit göttlicher Gnade ausgestattet sein wird: „Segne und behüte unseren Reichspräsidenten, lenke und erleuchte alle, die unser Volk regieren und führen … Setze sie uns allen in Glaube und Liebe zur christlichen Obrigkeit, zu schützen die Frommen und zu steuern die Bösen.“ Die Zeit der Leiden wurde in den Fürbitten nochmals als Argument gegenüber Gott angeführt, daß er nun den christlichen Wiederaufstieg fortführen möge: „Nachdem wir solange Unglück leiden, kehre Dich doch wieder zu uns und sei unserem Volk gnädig.‘“ Nach dem Segen setzte die Liturgie den Schluß- und einen weiteren Höhepunkt: im Niederländischen Dankgebet kulminierte im gemeinsamen Gesang die Zuversicht auf die Wende zum Besseren und das Selbstverständnis, auf der richtigen Seite zu stehen: „Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten; er waltet und haltet ein strenges Gericht. Er läßt von den Schlechten die Guten nicht knechten, sein Name sei gelobt, er vergißt unser nicht … Im Streit zur Seite ist Gott uns gestanden. Er wollte, es sollte das Recht siegreich sein. Da ward, kaum begonnen, die Schlacht schon gewonnen. Du, Gott, warst ja mit uns, der Sieg, er war Dein … Oh Herr, mach uns frei!“ Der Choral stand für die Befreiungskriege. Von daher floß auch in dieses Lied die geschichtliche Perspektive mit ein. Festzuhalten bleibt jedoch, daß in der kirchlichen Feier der Mythos Preußen in seiner religiösen Aufladung nicht die zentrale Rolle spielte, vielmehr ist eine von der lutherischen Tradition ausgehende Interpretation der Offenbarung nachzuweisen. Für Gläubige und Pfarrerschaft stand es fest, daß die nun berufene Obrigkeit nicht nur eine rechtmäßige, sondern auch diejenige ist, die in Verbindung mit der Einigung des Volkes die Reformation Luthers vollenden konnte! Deshalb war der Verweis auf Römer 13, 1 f. für Dibelius auch nicht zentral. Die evangelische Kirche sah sich geradezu gezwungen, den beginnenden Staatsterror zu unterstützen.
Fragt man nach den Wirkungen dieser Feier für die neue Reichsregierung, so wird deutlich, daß kirchliches Heil und damit der göttliche Segen gespendet wurde. Dies erhöhte, zumindest in den Augen kirchlicher Kreise und der Pfarrerschaft, die Legitimität Hitlers und verschaffte ihm auch die Aura des gottwohlgefälligen Herrschers.
3. Die katholische Feier in der St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche
Noch geringere Beachtung fand in der bisherigen Forschung das katholische Pendant zum evangelischen Gottesdienst. Die Interpretationen sehen auch hier die politischen Aspekte im Mittelpunkt. Die Abgeordneten des Zentrums seien, trotz ihrer Diskriminierung bei der Abfahrt nach Potsdam — Polizeibeamte wollten die Abgeordneten nach Waffen untersuchen —, von der „national-pompösen“ Szene des Potsdamer Staatsaktes beeindruckt worden[31]. Die Bischöfe hätten in Abkehr zu der Erklärung vom 20. Februar 1933 eine vorsichtige Annäherung gegenüber den neuen Machthabern vollzogen[32]. Wie in der Nicolaikirche stellten auch in der Peter-und-Paul-Kirche die (katholischen) Mitglieder der Reichsregierung, des Staatsrates und die Abgeordneten des Reichstages die Besucher: Der NSDAP gelang es erstmals, das bischöfliche Uniformverbot für katholische Gottesdienste zu durchbrechen: Die Abgeordneten der Regierungspartei wohnten dem Gottesdienst im Braunhemd bei. Stand Hindenburg als evangelischer „Ersatzbischof“ im Mittelpunkt der Feier in der Nicolaikirche, so war es hier der Vertreter des geistlichen Oberhauptes der katholischen Kirche, des unfehlbaren Papstes und Stellvertreters Christi auf Erden. Dies wird am Beginn deutlich: Als der Nuntius Orsenigo die Kirche betrat, knieten die Gläubigen, um seinen Segen zu erlangen. Nach seinem Eintritt begann der Gottesdienst, der einen auf das aktuelle Ereignis gerichteten Ablauf enthielt. Obwohl die Kirche in ihrem Schmuck der Fastenzeit entsprach — Altarparamente und die Gewänder der Priester zeigten sich in Violett —, zelebrierte man, dem Kirchenjahr nicht entsprechend, ein feierliches Leviten-Hochamt, das durch eine festliche Messe („missa stella maris“) musikalisch untermalt wurde. Das Hochamt feierten Priester, d.h. die Geweihten und damit zum Vollzug des Meßopfers befähigten Kleriker. Während der päpstliche Nuntius im Chor, also an herausragender Stelle, dem Gottesdienst beiwohnte, verrichtete der Domkapitular Prälat Dr. Barnasch als Vertreter des Bischofs das Meßopfer, assistiert von den Kaplänen der Kirche. Die Liturgie unterschied sich, das ist evident, in wesentlichen Bestandteilen vom evangelischen Gottesdienst, nicht jedoch in der Intention: Zunächst war wie vor dem zweiten Vatikanum üblich die Kultsprache Latein. Dies sollte gemäß katholischem Verständnis die Reinheit und den Geheimnischarakter des Kults, aber auch dessen Wirksamkeit ausdrücken. Das Lob Gottes war die eine Seite des Gottesdienstes, im zweiten Teil des Gottesdienstes, der Eucharistiefeier, kam zur Doxologie auch der Kultzweck hinzu, Heil für die Menschen herabzuflehen und für schon gespendetes Heil zu danken, also Lob- und Dankopfer sowie Bitt- und Sühneopfer. Auch die Gläubigen waren am „Erfolg“ des Gottesdienst beteiligt, sie besaßen zwar keine aktive „liturgische Potenz“, doch äußerten sie ihre Anliegen, ihr Bitten und ihr Gotteslob im gemeinsam gesprochenen Gebet, in den lateinischen Akklamationen und im Lied. Statt daß sich die göttliche Gnade in den Worten des Predigers offenbarte, fand das entscheidende Mysterium des katholischen Kultus in der, so der Festbericht, „feierlich vollzogenen Wandlung“ statt. In ihr wurde die wunderbare Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi vollzogen. Die sakramentale Anwesenheit des Gottessohnes war somit manifest und damit auch die Wiederkehr seiner Heilstat. Garantiert wurde dieses durch den richtigen, dem Missale Romanum entsprechenden Vollzug des Meßopfers: Vorbereitung der Gaben von Brot und Wein, Verrichtung der ausführlichen Gebete-zur Präfation, wobei auch die Laien im Sanktus und im Lied an der Gabenbereitung mitwirkten. Nach der Wandlung lag der göttliche Segen auf den Anwesenden und galt hinfort auch für den Zweck des Tages von Potsdam, für das Wirken des neuen Reichstages und der Regierung des Reiches. Dieser Aspekt wurde herausgestellt: Nachdem Prälat Dr. Barnasch das für die Fastenzeit unübliche Veni creator („Komm Schöpfer heiliger Geist“) anstimmte, rief er den göttlichen Segen auf die „Leiter des neuen Staates“ herab. Fragt man abschließend danach, ob auch die Katholiken im Rahmen des Gottesdienstes den Anbruch einer neuen Zeit, den Eingriff Gottes in das politische Geschehen konstatierten, so läßt der Charakter des Gottesdienstes darauf keinen Hinweis zu — der Eingriff Gottes ist sakramental immer, soweit die gültigen Regeln befolgt werden (ex opere operato), gewährleistet, doch: Im Gloria des Wortgottesdienstes wurde die Zeitenwende in den Worten des Weihnachtsevangeliums deutlich gemacht und in der Messe durch die feierliche Gestaltung besonders hervorgehoben: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen, die guten Willens sind“ — das Weihnachtsevangelium verkündet die Ankunft einer neuen Zeit. Inwieweit hierauf Bezug genommen wird, bleibt offen. Hier muß die regionale Fallstudie Aufschlüsse bringen.
Doch hatten es nicht alle Katholiken vorgezogen, dem Mysterium Meßfeier beizuwohnen und sakramentales Heil zu erlangen. Das Fehlen des Reichskanzlers Hitler und seines Propagandaministers Goebbels stand den Zentrumsabgeordneten und dem katholischen Episkopat als Menetekel vor Augen. Die Zeitungen des folgenden Tages brachten die Gründe in die Öffentlichkeit und verstärkten auf diese Weise den Druck auf Zentrum und Episkopat, die Distanz zum Nationalsozialismus abzubauen. Hierauf zielte die offizielle Ablehnung Hitlers: Mit der Erklärung vom 20. Februar 1933 sowie weitere Erklärungen hätten die Bischöfe „Führer und Mitglieder der NSDAP als Abtrünnige der Kirche bezeichnet, die nicht in den Genuß der Sakramente kommen dürfen“[33]. Die beiden Nationalsozialisten entzogen sich nicht nur der Kirche, sie setzten neue Akzente. Indem sie auf dem Berliner Luisenstätter Friedhof die Gräber von Horst Wessel und einem anderen ermordeten Nationalsozialisten besuchten, ehrten sie Märtyrer der Bewegung und deuteten damit die in Teilen des Nationalsozialismus vorhandene, von der christlichen Offenbarung gänzlich unterschiedene Religiosität an, die den Nationalsozialismus als neue Religion und Kirche sah.
4. Die Feier in der Garnisonkirche — Weihe und Berufung
Orientierten sich die beiden Gottesdienste noch an den liturgischen Gepflogenheiten und den Glaubensaussagen der Konfessionen, so war die Feier in der Garnisonkirche ein Ereignis, in dem sich im gemeinschaftlichen Handeln Glaubensäußerungen zeigten, die außerhalb kirchlicher Deutungen standen. In ihr gab es zwar in Gestalt von christlichem Liedgut und Versatzstücken der Liturgie Anknüpfungspunkte zu den Anstaltskirchen und ihrem Heilsangebot, doch im Zentrum des Glaubens standen eine Heilsgeschichte, in der das Schicksal der deutschen Nation die christliche Eschatologie verdrängte, und ein deutscher Nationalgott, der mit dem deutschen Volk einen neuen „deutschen Bund“ geschlossen hatte. Diese Gestalt Gottes war jedoch nicht absolut in ihrer Größe, wie es der Protestantismus deutete, sondern — durchaus in Parallelität zur katholischen Volksfrömmigkeit — in ihrer Wirksamkeit den Menschen nahe durch eine Do-ut-des-Mentalität, die den gerechten göttlichen Lohn für die Erfüllung „deutscher“ Tugenden sah, und durch heilige Gestalten, vergegenwärtigt in Reliquien der preußischen Könige. Dieser Synkretismus einer neuen Nationalreligion, der anstaltliche Merkmale fehlten, spiegelt eine Säkularisierung bzw. Nationalisierung von Kirchlichkeit wider. Die Feier in der Garnisonkirche war demzufolge kein Theaterspiel mit verstaubten Requisiten, sondern ritueller Ausdruck eines Glaubensverständnisses, in dem Mythos und christliche Religion eine Verbindung eingingen. Hieraus erwuchs das religiös überhöhte Charisma Hitlers.
Der Ablauf
Im Mittelpunkt standen nicht die Geistlichen; der Reichspräsident und der Reichskanzler waren es, die mit ihren Reden und ihrem Handeln der Feier ihren Stempel aufdrückten. Die Kirche als Ort des Gottesdienstes und die Kirche als Institution nutzte man nur noch als Staffage. Dies wird bereits an dem Beginn der Feier deutlich: Während die Reichsregierung, die Abgeordneten und die sonstigen geladenen Gäste bereits Platz gefunden hatten, vollzog sich vor dem Gotteshaus der Empfang Hindenburgs: der Regierungspräsident, der Oberbürgermeister der Stadt und die Pfarrer der Garnisonkirche als Hausherren begrüßten ihn.
In dem Moment, als Hindenburg das Innere der Kirche betrat, erhoben sich alle Anwesenden: Hindenburg galt zunächst die Aufmerksamkeit, ihm wurde dieselbe Ehre zuteil, die sonst beispielsweise dem katholischen Pfarrer im Gottesdienst zukommt. „Tief prägt sich dieser überwältigende Augenblick ein: Deutschlands großer Generalfeldmarschall und Reichspräsident betritt die Garnisonkirche, …“ Als Ersatzkaiser ehrte er das Hohenzollernhaus, indem er mit seinem Marschallstab den Sitzplatz des in Holland weilenden Wilhelm II. grüßte, als „Ersatzbischof“ kam dem Reichspräsidenten ein herausgehobener Platz in der Kirche zu — Hindenburg machte sich auf den Weg, den ihm zugewiesenen Sitz unmittelbar vor dem Altar, der Kanzel und der Gruft einzunehmen. Unterdessen spielt der Organist den Choral von Leuthen: „Nun danket alle Gott“! Damit war musikalisch an das Wirken Friedrichs II, erinnert. Der König stand den Teilnehmern nun vor Augen.
Dermaßen an den Aufstieg Preußens und den Beistand Gottes in der Geschichte erinnert, konnte Hindenburg seine Rede beginnen. Er gab dem Ort des Geschehens, der Garnisonkirche, den Charakter einer religiösen Weihestatte: Es sei ein besonderer „alter Geist dieser Ruhmesstätte‘“ zu verspüren, der auch das „heutige Geschlecht beseelen“ möge. Mit diesen Worten knüpft Hindenburg an die Bedeutung der Garnisonkirche als Wallfahrtsort, denn auch das, was eigentlich Vergangenheit ist, kann in der Garnisonkirche empfunden werden. Die Tugenden des Preußentums sind jedoch auch für Hindenburg gekoppelt an eine höhere Macht, an Gott: „In Gottesfurcht ist das alte Preußen durch pflichttreue Arbeit, nie verzagendem Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden.“ Dies solle heute wieder an Aktualität gewinnen. Der Choral von Leuthen und der Rückbezug auf Gott sind folglich die eine Seite, die zukünftiges Heil für das ganze Volk im Einigungsprozeß garantieren sollen. Für Hindenburg tritt eine zweite Komponente hinzu: in der Grabesstätte der Preußenkönige spürt man den „alten Geist“, d. h. preußische Geschichte gerät durch die Anwesenheit der Könige zur Religion. Gott und die Stätte mit ihren Heiligen machen die besonderen Heilswirkungen aus. Die Rede ist ein erstes Argument für die sakrale Funktion des Reichspräsidenten, der die Jetztzeit mit der Vergangenheit nicht nur durch sein hohes Alter verbinden kann, sondern auch durch seine Fähigkeit, transzendente Bezüge herzustellen. Damit ist er nicht nur Ersatzbischof, er fungiert vielmehr auch als Priester einer nicht anstaltlich gebundenen Religion.

Diese Aufgabe Hindenburgs betont Hitler in seiner Regierungserklärung, die er am kunstvollen Lektorenpult der Kirche halten darf (Abb. 5). Wenn auch Hitler Gott explizit nicht erwähnt, so ist er noch in dem mehrfach erwähnten Begriff der Vorsehung angedeutet. Diese Vorsehung habe Hindenburg zum „Schirmherrn“ für die „neue Erhebung unseres Volkes‘ werden lassen. Dieser nicht mehr christliche Gott hat, so meine Interpretation von Hitlers Worten, Hindenburg den Auftrag gegeben, den politischen Wandel einzuleiten und zu beschirmen. Dermaßen schon in die Nähe Gottes gerückt, kann Hitler Hindenburg zu einem Menschen mit besonderer Gnadenkraft herausheben: Er habe ein „wundersames Leben“ geführt, das ein „Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation“ sei. Das ganze Volk empfinde das Eintreten des Reichspräsidenten für das „Werk der deutschen Erhebung als Segnung“. Hindenburg ist somit, religionsphänomenologisch gesprochen, eine Kraftquelle, die ihren Ursprung jedoch in der „Vorsehung“ oder in der Gestalt des deutschen Nationalgottes hat. Doch Hitler verweist zu Recht auf die zweite Fundierung der besonderen religiösen Qualitäten Hindenburgs, abseits von seiner kirchlichen Funktion. Seine Kraft ist eben auch darin begründet, daß er durch seine Verkörperung preußischer Traditionen berufen ist, die Aura der großen Preußenkönige zu vermitteln. „Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden Deutschen geheiligten Raum um uns spüren, als für unseres Volkes Freiheit und Größe ringende Menschen zu Füßen der Bahre seines größten Königs.“
Unmittelbar nach der Rede kam es zu dem, was die zentrale Botschaft des Tages von Potsdam sein sollte: die Verbindung des alten Deutschlands mit der neuen Kraft des Nationalsozialismus per Handschlag: „Ein inniger, kräftiger Händedruck zwischen dem greisen Feldmarschall und dem jungen Kanzler der nationalen Erhebung besiegelte den Bund“; dazu spielte die Orgel und sang der Chor eine Motette von Brahms, dann das „machtvolle‘“ Amen der ganzen Gemeinde[34]: „Ja, so sei es“, so die Bedeutung des Wortes. Folglich war der Händedruck nicht nur symbolischer Ausdruck von Wertschätzung, vielmehr war er vor dem Hintergrund der religiösen Vorstellungen der Zeitgenossen Weihe und an die kirchliche Eheschließung erinnernde Gemeinschaft zugleich. Diese verdankten jedoch ihre tiefere Begründung den besonderen Gnaden der Wallfahrtsstätte.
Den folgenden Akt konnte vor diesem Hintergrund nur Hindenburg vollziehen: Ausschließlich der von der „Vorsehung“ Berufene, durch sein „wundersames Leben“ ausgezeichnete Garant des nationalen Aufstiegs und Wissende um die preußische Vergangenheit war berechtigt, in der Krypta der Kirche Kränze an den Särgen der Könige niederzulegen[35]. Die Pfarrer geleiteten als Hausherren Hindenburg und seinen Sohn zu ihrem Reliquienschatz, den Heiltümern der Garnisonkirche. Beim Betreten der Gruft wurde nochmals das Niederländische Dankgebet angestimmt, also die Anknüpfung an preußisch-protestantische Traditionen und das Wirken Gottes in der preußischen Geschichte. Als Hindenburg die Kränze vor die Särge legte, waren 21 Schuß der Salutbatterie zu hören. Auch hier fallen rituelle Parallelen zur kirchlichen Liturgie auf: Bei der katholischen Eucharistiefeier erinnert eine Glocke an die vollzogene Wandlung; im evangelischen Gottesdienst Läuten an das beim Schluß des Gottesdienstes von der Gemeinde gesprochene Vaterunser. Insofern hatte dieser Gang den Charakter einer Kontaktaufnahme mit der durch Ort, Liedgut und Zeiterfahrung ermöglichten Realpräsenz des preußischen Nationalheiligen Friedrich II. Durch diesen zentralen Akt der Feier war der oberste Priester Hindenburg nicht nur ausgestattet mit der Gnade der „Vorsehung“, er war auch durchdrungen von dem „alten Geist“ (Hindenburg) der Stätte, den es zu übertragen galt: Nach der Rückkehr aus der Gruft erhob Hindenburg wie zu Beginn der Feierlichkeit seinen Marschallstab und grüßte die Anwesenden in der Kirche. So bündelte sich in diesem Tun der gesamte liturgische Ablauf. Dann geleitete Hitler, nun vollends mit dem Einverständnis übernatürlicher Mächte ausgestattet, Hindenburg zum Ausgang.
Die Legitimation des neuen Herrschers auf religiöser Grundlage ist der zweite Akt der Machtergreifung nach der bürokratisch-legalen i. S. der Weberschen Herrschaftssoziologie Beauftragung mit den Regierungsgeschäften durch den Reichspräsidenten aufgrund seiner verfassungsmäßigen Vollmachten. Dieser Händedruck, durch das nachfolgende Handeln des obersten Priesters zum sakramentalen Akt erwachsen, wird auch in der zeitgenössischen Publizistik als Weihe verstanden. Die Zeitschrift Der Tag bringt es auf den Punkt: „Der Repräsentant dieser Zeit grüßt die Großen der Vergangenheit und bringt, aus der Gruft wiederemporschreitend, als ehrfurchtgebietender Mittler dem Jungen Geschlecht den Segen vergangener Jahrhunderte zurück.“
Bedingung für den gültigen Vollzug der Weihe war jedoch das Vorhandensein der Reliquien. Die Parallelen zu den Krönungsordines der Könige und Kaiser vor dem Investiturstreit springen ins Auge: Während die hochmittelalterlichen Herrscher jedoch ihre Stellung als Priesterkönige in einer kirchlich-christlichen Salbung erlangten und dabei Reliquien als Garanten der Wahrheit und Echtheit dieses Vorgangs eine zentrale Rolle spielten, löste sich der Weiheakt 1933 aus dem kirchlichen Kontext. Jedoch bleibt die Einheit von göttlicher Legitimation und politischer Macht erhalten, nun garantiert durch die Anwesenheit der preußischen Könige in ihrer Grablege. Das genaue Verhältnis zwischen göttlichem Heil und dem Segen der Könige bleibt offen, es war eine Gemengelage, je nach den individuellen Dispositionen der Teilnehmer. Entscheidend für die Rekonstruktion der Wahrnehmungshorizonte ist, daß Gott und der „große“ König ihr Einverständnis erteilt haben, Hitler mit dem Neuaufbau eines einigen Reiches zu betrauen.
Nun mag eingewandt werden, diese Interpretation der Feier in der Garnisonkirche sei in ihrer religionssoziologischen und religionsphänomenologischen Perspektive weit hergeholt. In Wirklichkeit sei das Ritual wie auch das vor kurzem in Potsdam geschehene ohne religiöse Sinnstiftung vonstatten gegangen. Dann dürfte jedoch die Stimmung des Tages für die Beteiligten nicht so „ergreifend“ gewesen sein. Dafür sprechen die Zeugnisse ausländischer Beobachter; ein Zeuge ist auch der Arrangeur der Festlichkeit: Goebbels schreibt in seinem Tagebuch, daß alle Teilnehmer Potsdam „erschüttert“ verlassen hätten. Selbst der durchtriebene Propagandaminister sieht Hindenburg ohne Ironie in die Nähe Gottes gerückt: „Er steht und grüßt. Über alldem liegt die ewige Sonne, und Gottes Hand steht unsichtbar segnend über der grauen Stadt preußischer Größe und Pflicht“[36].
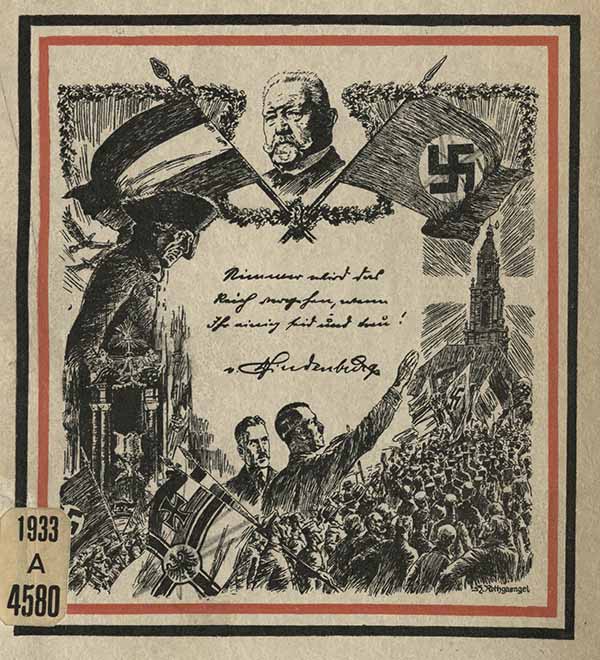
Auch ikonographische Interpretationen vermögen die religiöse Dimension des Tages von Potsdam zu stützen. Aufschlußreich vor allem das Titelblatt der Erinnerungsschrift Hupfelds, in dem sich dieselben Elemente einer synkretistischen Nationalreligion wiederfinden. Im unteren Teil des Bildes wird die politische Dimension des Tages angedeutet (Abb. 6), nämlich die Verbindung von altem und jungem Deutschland. Die Kolonnen der jungen SA-Männer und die Vertreter des alten Reiches, erkennbar an der Reichskriegsflagge, marschieren zu einem gemeinsamen Ziel, der im Nimbus erscheinenden Garnisonkirche. Folglich handelt es sich bei dem Gang der uniformierten Männer um eine Wallfahrtsprozession, denn ihr Ziel ist ein heiliger Ort, der sich durch die Gräber der beiden Preußenkönige auszeichnet. Die Realpräsenz der Heiligen am Wallfahrtsort findet an der linken Bildseite ihren Ausdruck: deutlich zu erkennen sind die Gruft, die darüber befindliche Kanzel und das Dreieck, das Auge Gottes, in Verbindung mit dem preußischen Adler. Aus der Gruft, gekoppelt jedoch an Predigt und Gott, steigt, wenn man es so sagen darf, Friedrich II. als der Diesseits und Jenseits verbindende Heilige auf. Der König ist in seiner Ikonographie den Zeitgenossen bekannt, denn das Porträt lehnt sich an die Zeichnungen von Adolph Menzel an; auch Gruft und Kanzel sind Menzel nachempfunden. Die Adler verweisen auf das Ringen des Königs in der schweren Zeit des Siebenjährigen Krieges. Auch dieses Motiv findet sich in der Geschichte Friedrichs von Kugler und Menzel[37]. Solchermaßen erfahrbar, verweisen Garnisonkirche und die Gestalt des Königs auf Hindenburg, den Vertreter des deutschen Reichsgedankens, der quasi als Gottvater, zumindest aber als Spitze der priesterlichen Hierarchie dargestellt wird. Seine Attribute sind die Fahne des alten und die des neuen Reiches. Die Beauftragung durch Gott (Auge Gottes und Predigtstuhl) und durch den König gibt Hindenburg die Vollmacht, die Herrschaft nun einem jüngeren, entschlußkräftigen Mann in die Hände zu legen. Was bei der Feier in der Garnisonkirche durch Handschlag und Besuch der Krypta seinen liturgischen Ausdruck fand, wird im Bildaufbau durch den achsenmäßigen Bezug zwischen Hitler und Hindenburg in Szene gesetzt. Gleichzeitig demonstriert der aufschauende Papen sein Einverständnis mit dieser Beauftragung: Die Botschaft von Hindenburg sind die Worte von Goebbels‘ Aufruf „Nimmer wird das Reich vergehen, wenn Ihr einig seid und treu“. Dermaßen die Weisung Hindenburgs beherzigend, zeigt der in sein Amt eingeführte Hitler den Wallfahrern den Weg und verheißt gleichzeitig mit einer Geste, die Hitlergruß und Segnung zugleich ist, eine bessere Zukunft. Bis hierhin kann die Deutung des Bildes und damit der mentalen Dispositionen der Zeitgenossen auf kirchliche Sichtweisen und christliche Offenbarung verzichten. Die religiöse Herrschaftslegitimierung Hitlers könnte jedoch auch mit einem Bild des Neuen Testamentes assoziativ verbunden sein, der Taufe Christi im Jordan. Hindenburg als „Schirmherr“ des deutschen Volkes kann in der Garnisonkirche die Macht auf jemanden übertragen, der ihn an Größe überragt: Hindenburg, der Ältere und ‚Täufer‘, kennt die Tatkraft des Jüngeren, dessen Fähigkeit, dem Willen Gottes zu entsprechen. Auf ihm ruht also der wohlgefällige Blick Gottes. Das biblische Geschehen stellt Bezüge her, wenn auch nicht auf die Gottessohnschaft von Anfang an, so doch zumindest auf die Adoption: „siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ Einerlei, ob die Begründung des Charismas Hitlers und damit seiner Herrschaftslegitimation in dem Handschlag Hindenburgs und der damit erfolgten „Kraftübertragung“ oder in der Assoziation mit der Taufe am Jordan begründeten messianischen Komponente des Führers beruhte, das Ergebnis des Tages von Potsdam in seiner religiösen Dimension wird deutlich: Kirchliches Heil und die aus den nationalen Mythen sich kristallisierende, kultisch verselbständigende Nationalreligion begründeten den Herrschaftsanspruch Hitlers. Ein solches Ritual erzeugte Begeisterung und religiöses Vertrauen in die außeralltäglichen Qualitäten des neuen Reichskanzlers, die sich über den Tag von Potsdam und die zwei Tage später stattfindende Sitzung des Reichstages in der Krolloper hinaus erstreckten.
Die Vertreter der evangelischen Kirchen der Altpreußischen Union standen noch zwei Wochen später unter dem nachhaltigen Eindruck des Tages von Potsdam. Sie hatten ja in der Nicolaikirche der neuen Regierung den kirchlichen Segen gegeben, hatten auch der Feier in der Garnisonkirche beigewohnt und dabei die bekannten Choräle und Reminiszenzen an die preußische Geschichte erfahren. So sahen die Kirchenmänner den Tag nun nahtlos eingereiht in den kirchlichen Kalender, denn in ihrer Osterbotschaft kann man den Tag von Potsdam wiederfinden. Die Auferstehung Christi fand so eine neue heilsgeschichtliche Dimension: „Die Osterbotschaft von dem auferstandenen Christus ergeht in Deutschland in diesem Jahr an ein Volk, zu dem Gott durch eine große Wende gesprochen hat.“ In der Botschaft spiegelt sich die dynamische Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre Luthers, wie wir sie schon in der Predigt von Dibelius gefunden haben: Es ist nicht mehr Aufgabe der evangelischen Christenheit, der rechtmäßigen Obrigkeit untertan zu sein, sondern aktiv zu helfen: „Sie ist freudig bereit zur Mitarbeit an den nationalen und sittlichen Erneuerungen unseres Volkes“[38]. Dies gilt mit Einschränkungen auch für die Katholiken, wollte man bei dieser nationalen Einigung nicht ausgegrenzt bleiben. Der ungeheure Eindruck, den die Vermittlung kirchlichen Heils machte, ließ es der Zentrumsfraktion u. a. ratsam erscheinen, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen; die Bischöfe verstanden die Drohgebärde Hitlers in Gestalt seines Fernbleibens bei dem katholischen Gottesdienst richtig, hörten aber auch aus seinen Reden heraus, daß das Christentum und damit auch der Katholizismus in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werde.
Im folgenden soll am Beispiel Westfalens der rituelle Nachvollzug des Tages Gegenstand sein. Hier werden Argumente zu suchen sein, die die oben gemachten religionssoziologischen und religionsphänomenologischen Deutungen stützen können. Zudem liegt das Erkenntnisinteresse der Fallstudie darin begründet, den Tag von Potsdam nicht als isoliert dastehendes Ereignis zu betrachten, sondern seine Ausstrahlung auf breite Gruppen der Bevölkerung zu belegen. Die Fallstudie leistet insofern einen Beitrag, die religiöse Tiefendimension und die kirchlichen Deutungen verallgemeinerbar zu machen. Sie könnte auch eine genauere Antwort auf die Frage geben, wie das Spannungsverhältnis zwischen Kirchen und nationaler Religion aussah und wie sich dieses im Verhalten von kirchlichen Amtsträgern und Laien konkret äußerte.
III. Die Feier in Westfalen
Die Ereignisse in Potsdam standen nicht isoliert da. Was sich in den Berichten der Nachrichtenbüros nur als kurze Notiz niederschlägt („aus Anlaß der Reichstagseröffnung fanden auch im ganzen Reich würdige Feiern statt“), läßt sich bei näherer Betrachtung als Nachvollzug und eigenständige Ausgestaltung des Ereignisses mit wenigen Ausnahmen selbst in der kleinsten Ortschaft nachweisen.
1. Voraussetzungen
Zentrale Bestandteile der Feierlichkeiten in Potsdam gehörten zur nationalen Festkultur und zu den gottesdienstlichen Feiern in Westfalen. Dies gilt beispielsweise für die in Potsdam verwandten Lieder. Der Choral von Leuthen und das Niederländische Dankgebet stellten einen unverzichtbaren Bestandteil der Gedenkfeiern der Völkerschlacht von Leipzig 1813 oder von Regierungsjubiläen dar. Die evangelischen Gläubigen von Versmold im Ravensberger Land feierten in ihrer Kirche das 100jährige Jubiläum der Befreiungskriege. Das Schlußlied bildete der Choral von Leuthen: Die Gemeinde sang die erste Strophe stehend, bei der zweiten Strophe untermalten Glocken den Gesang, dann setzte auch die Orgel ein[39]. Als man in Bielefeld 1913 das Regierungsjubiläum von Kaiser Wilhelm II. feierte, begann der Gottesdienst mit dem Niederländischen Dankgebet[40]. Zu einem Massenereignis wurde 1896 der Besuch des Kaisers anläßlich der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Porta Westfalica, 1 300 Posaunenbläser huldigten im Spalier dem Kaiser. Als dieser den Rückweg nach Minden antrat, war als Schlußpunkt ihres Abschieds „Nun danket alle Gott“ vorgesehen[41]. Auch in der Arbeiterschaft, zumindest der christlich orientierten, waren diese Lieder bekannt. Der Jöllenbecker Posaunenchor bereicherte die Jubiläumsfeier des christlichen Textilarbeiterverbandes mit dem Niederländischen Dankgebet[42]. Auch im katholischen Bereich hielten die beiden Choräle gelegentlich ihren Einzug[43].
man in Zentrumskreisen in Westfalen der Weimarer Republik zumeist wohlwollend gegenüberstand, sah man insbesondere im Klerus die Gefahren des Atheismus in Verbindung mit dem zunehmenden Bedeutungsverlust kirchlicher Normen und Werte. Zudem wurde die allmähliche Auflösung des katholischen Milieus konstatiert und auf Abhilfe gesonnen[44]. Generell war die Loyalität zum Weimarer Staatswesen jedoch vorhanden, wenn auch autoritär-ständische Konzepte im Kommen waren. Anders sah es in protestantisch-nationalkonservativen Kreisen aus.
Die Distanz zu dem durch „Revolution“ und militärische Niederlage zustandegekommenen ersten deutschen demokratischen Staatswesen läßt sich von 1918 bis 1933 nachzeichnen. Kriegervereine, Jungdeutscher Orden, konservative Parteien und gegen Ende der Republik der Stahlhelm waren Organisationen des bürgerlichen oder großbäuerlichen Vereinswesens, in denen sich auch kirchliche Kreise inklusive der Pfarrerschaft wohlfühlten. Die nationalkonservativen Pastoren wohnten Kriegerfesten bei, auf denen man sich in das Kaiserreich zurücksehnte, hielten Feldgottesdienste ab und diskriminierten die als sozialdemokratisch oder kommunistisch verdächtigte Arbeiterschaft bei vielen Gelegenheiten, selbst bei Beerdigungen[45]. Viele Pfarrer sahen die Weimarer Republik als Zeit der Not und der gottgewollten Prüfung. 1929 fanden sich Bielefelder Protestanten anläßlich des zehnten Jahrestages des Versailler Vertrages zu einem Gedenkgottesdienst in der Altstädter Kirche ein, Pastor Köhler malte in seiner Predigt den Niedergang Deutschlands an die Wand. Ein neuer Wiederaufstieg sei erst dann möglich, „wenn das deutsche Volk die Frage ‚wuchs und reifte ich durch all diese Not?‘“ beherzige. Die Hoffnung auf Besserung klammerte sich an die Gestalt Hindenburgs. Er galt bei den Protestanten Westfalens als Schutzherr des Reiches und des protestantischen Glaubens. In Ersatz für die Feier von „Kaisers Geburtstag“ hielt man etwa in Bielefeld am 2. Oktober 1932 — Hindenburgs Geburtstag — eine Feier auf dem Johannesberg ab. Die Stellung Hindenburgs als priesterliche Gestalt, die einen göttlichen Auftrag habe, wird in einem Gedicht deutlich, das ihm die Bielefelder widmeten. Zunächst dankt der Autor Gott, daß er Deutschland das „teure Leben“ Hindenburg geschenkt habe. Hindenburgs stetes Bestreben sei es gewesen, in „Kampf und Leiden für die Deutschen Wach’“ zu stehen, für sein Volk, seine „Herde“. Das Dank- und Bittgebet läßt also die Assoziation von Hindenburg als guten Hirten aufkommen, macht ihn zur christusähnlichen Gestalt. Das Leiden des alten Mannes solle Gott doch beherzigen, um ihm „ein bißchen Sonne vor dem Scheiden“ zu vergönnen. Dieses sei die Zeit, in der das deutsche Volk wieder geeint werde, in der der „heilige deutsche Name von allen Völkern vernommen wird“. Die Zeilen enden in einem beschwörenden Stoßgebet: „Die Stunde noch! Die Stunde, Gott im Himmel!“[46] Am 21. März 1933 sahen viele Bielefelder ihre Gebete erhört.
2. Grundzüge[47]
Die Voraussetzungen für eine Heraushebung des Tages aus dem Wochenablauf wurden von der Reichsregierung und den Länderregierungen sowie den kommunalen Verwaltungen geschaffen. Für die preußischen Behörden erging die Anweisung, Hakenkreuz und schwarz-weiß-rot zu flaggen; die Beamten waren angewiesen, Sonntagsdienst zu verrichten und die frei werdende Zeit für die Teilnahme an den örtlichen Feierlichkeiten zu verwenden. Gleiches galt für die Kommunalbeamten. In der preußischen Provinz Westfalen ebenso wie im Land Lippe fiel für die Schulkinder der Unterricht aus, um geschlossene Schulfeiern zu ermöglichen, in deren Mittelpunkt die Übertragung der Feier in der Garnisonkirche stehen sollte. Die Gewerbeämter wiesen die Geschäftsinhaber an, von 12 bis 14 Uhr die Ladenlokale zu schließen, um auch auf diese Weise eine ungestörte Rundfunkübertragung zu ermöglichen[48]. Die weitere Ausgestaltung der Feierlichkeiten wurde hingegen nicht von oben dirigiert.

Initiativbildend war jedoch der Aufruf von Goebbels, der die „nationalen Verbände“ im ganzen Reich aufgerufen hatte, die Feier der Reichstagseröffnung durch abendliche Fackelzüge und, wo möglich, Feuer auf den Bergen nachzuvollziehen. Diese Gruppen waren es denn auch, die in Verbindung mit den Spitzen der örtlichen Verwaltungen organisatorisch tätig wurden. Es beteiligten sich insbesondere Kriegervereine, Stahlhelm, bürgerliche Turnvereine, Schützenvereine, freiwillige Feuerwehr, bürgerliche Gesangvereine, deutschnationale Formationen als Vertreter des nationalen Spektrums, NSDAP, SA, SS, Hitlerjugend als Vertreter der Nationalsozialisten (Abb. 7). Diese Gruppen besprachen sich, wie der abendliche Fackelzug durchgeführt werden konnte, überlegten, wer für die Reden in Frage kam. Ein Beispiel aus dem Ravensberger Land ist die Gemeinde Spenge, wo sich aufgrund von Interviews und Archivüberlieferung die Organisation nachzeichnen läßt[49]. Der Bürgermeister koordinierte die Vorbereitungen, indem er die einzelnen Vereine und Verbände zu einer Zusammenkunft aufrief. Stahlhelm, Kriegerverein, Deutsche Turnerschaft, Sanitätskolonne, freiwillige Feuerwehr und evangelischer Männer- und Jünglingsverein waren vom bürgerlich-nationalen Milieu her beteiligt. Es waren dieselben Gruppen, die die Verfassungsfeier des Jahres 1932 hatten platzen lassen. Zu diesen Gruppen stieß die SA. Man kam beim örtlichen Buchhändler zusammen, der die notwendigen Fackeln beschafft hatte. Darüber hinaus lud der Bürgermeister von Spenge die Einwohnerschaft ein, sich am abendlichen Fackelzug zu beteiligen. In Lünen trafen sich sämtliche Gesangvereine des Ortes zu einer Probe am Montagabend, bei der der gemeinsame Auftritt eingeübt werden sollte. Zusammen mit dem Bürgermeister riefen der Verband der militärischen Vereine, Stahlhelm und die NSDAP die Bevölkerung auf, schwarz-weiß-rot und Hakenkreuz zu flaggen und am Fackelzug teilzunehmen. Ähnliche Aufrufe gibt es für Orte, in denen der Katholizismus prägendes Moment war. Auch hier zeichneten lokale Verwaltungsbeamte und die militärischen Vereine für die Organisation und Einladung verantwortlich. Als Ziel der abendlichen Fackelzüge rückten zentrale Plätze, herausgehobene landschaftliche Gegebenheiten und die aus den nationalen Festen bereits hinlänglich im Mittelpunkt stehenden Kriegerdenkmäler bzw. Denkmäler der Befreiungskriege ins Blickfeld. Einige Beispiele für die Geschichte und Mythen vermittelnde Platzwahl: in Porta Westfalica bot sich das Kaiser-Wilhelm-Denkmal über dem Ort an; in Bielefeld erkoren sich die nationalen Vereinigungen den Ort, an dem schon 1932 das Geburtstagsfest des Reichspräsidenten stattfand, den Johannesberg; und in Bad Oeynhausen war als Zielpunkt eine Insel im Kurpark bestimmt. Wo es die landschaftlichen Gegebenheiten zuließen, griff man die Anregung des Propagandaministers, „Freudenfeuer“ auf den Bergen anzuzünden, dankbar auf, so in Halver und Brügge im märkischen Industrierevier und an der Porta.
An allen Orten fanden Schulfeiern statt, in denen Lehrer die Einführung in die Übertragung aus Potsdam gaben. In Städten, in denen Militär oder größere Polizeieinheiten stationiert waren, gab es bereits mittags eigenständige Veranstaltungen.
3. Die Feier im evangelischen Westfalen
Zunächst ist festzuhalten, daß es für die evangelische Kirche keine Richtlinien für die Zelebrierung des Tages gegeben hat. Predigthinweise, Anordnungen zur Gottesdienstgestaltung oder sonstige Anweisungen, den Tag feierlich zu begehen, können nicht nachgewiesen werden[50]. Überblickt man die Zeugnisse zur Feier, so fällt mit Ausnahme der Militär- und Polizeistandorte auf, daß nur an wenigen Orten gottesdienstliche Einleitungen des abendlichen Fackelzuges stattgefunden haben. Einige Ausnahmen sind zu nennen: besonders im märkischen Industrierevier gab es eine Einheit zwischen Fackelzug und kirchlicher Feier, so in Herscheid und in Milspe bei Schwelm. Dort fand ein „vaterländischer Dank- und Bittgottesdienst“ statt. Einige Hinweise lassen sich auch noch auf Gemeinden im Ostwestfälischen finden, so in Hagedorn (Häver).
Militärseelsorger oder Pfarrer, die mit der Seelsorge der Polizei betraut waren, übernahmen es in den morgendlichen Gottesdiensten, ihre Interpretation des politischen Geschehens und der sakralen Ereignisse in Potsdam zu verkünden. Kirchlich vermittelte Frömmigkeit und damit liturgisch abgesicherte Heilsspendung nahmen nicht die hohe Bedeutung ein, wie ich sie für Potsdam herausgearbeitet habe. Dies kann zunächst eine ganz profane Ursache gehabt haben: Nach wie vor war der 21. März ein Arbeitstag. Ein abendlicher Gottesdienst war unüblich, und von daher entfiel eine solche Einleitung für den Fackelzug. Vielmehr verließen sich die Kriegervereine und nationalen Verbände unter Einschluß der NSDAP auf die schon Jahrzehntelang bewährten Abläufe nationaler Feierlichkeiten. Elemente von Kirchlichkeit waren integrale Bestandteile der Ehrung der Kriegsgefallenen, der Kriegerfeste und nationaler Weihestunden. Viele der Pfarrer waren an führender Stelle in den nationalen Verbänden tätig und nahmen auf diese Weise an den Feierlichkeiten teil, einige sogar in herausragender Stellung als Redner. An den Orten, an denen für Polizei und Garnison Gottesdienste stattfanden, nutzte die Bevölkerung die Gelegenheit zur Teilnahme.
Die Bereitschaft, dem Tag von Potsdam auch in Westfalen kirchliches Heil nicht zu versagen, wird aus den Predigten der mittäglichen Feldgottesdienste, den Reden von Pfarrern im Verlaufe der abendlichen Feiern und aus den wenigen Belegen für die Integration kirchlicher Feiern in das abendliche Geschehen deutlich. Zunächst soll jedoch ein führender Vertreter des westfälischen Protestantismus zitiert werden, zum einen im Hinblick auf seine kirchlich-theologische Deutung, zum anderen daraufhin, ob sich Elemente der nationalen Religion nachweisen lassen.
Der ehemalige Generalsuperintendent von Westfalen, Wilhelm Zoellner, hielt am Vorabend des Tages von Potsdam einen Vortrag, in dem sich ähnlich der Predigt von Dibelius die religiöse Erfahrung einer „Zeitenwende“ findet[51]. Anknüpfungspunkt ist für ihn die Reformation, in der die Gnade Gottes nach „schwerster Notzeit“ allen zuteil wurde. Doch dann, so Zoellners Geschichtstheologie, habe das deutsche Volk „nach den ersten schönen Anfängen diese Gnade verschmäht“. Es begann das Zeitalter des Individualismus und der Aufklärung. Nun sei etwas „Neues“ angebrochen, der „Gedanke des Volkstums“ sei anerkannt worden, insbesondere auch durch die völkische Bewegung. Volkstum bringe es nämlich mit sich, dem Glauben eine zentrale Bedeutung zuzusprechen. Die Aufgabe der evangelischen Kirche bestehe insofern darin, als „Leuchtturm“ die Botschaft der Reformation nun wieder in das Volk zu tragen. Die von Gott eingesetzte Obrigkeit müsse jeder Christ anerkennen und seine Pflicht als Christ und als Staatsbürger tun, auf der anderen Seite sich nach den Geboten Christi, dem „Gesetz der dienenden Liebe“, verhalten. Wenn man Zoellner richtig versteht, hat die NS-Bewegung mit ihrer Betonung des christlichen Gedankens der Kirche die Möglichkeit eröffnet, eine neue Reformation anzustreben, was die Unterstützung der Kirche für die neue Regierung begründen hilft. Die dynamische Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre veranlaßt Zoellner zu folgendem Bekenntnis: „Wir stellen uns heute am Vorabend des 21. März auf den Boden der völkischen Bewegung. Wir stellen uns so darauf, daß wir auf diesem Boden kämpfen wollen für die Einsetzung des reformatorischen, d. h. des biblischen Glaubens, in der Kraft des geoffenbarten Evangeliums in seiner Kirche, zum Dienst an Volk und Vaterland. So stehen wir heute Abend in heißem Gebet für den Tag und den Abschnitt, der morgen in dem feierlichen Akt kundgetan wird. Möge der Tag der Umkehr unseres Volkes auch ein Tag der Umkehr werden zu dem lebendigen Gott!“
Die Erfahrung vom göttlichen Eingriff in die Welt nach einer Zeit des Niederganges und die daraus resultierende Bejahung des neuen Staatswesens leiteten auch andere Pfarrer Westfalens und machten es ihnen leicht, die göttliche Gnade für das Handeln der Regierenden herabzuflehen. Stand Zoellner fest in der Tradition des lutherischen Protestantismus, so läßt sich in den Predigten oder Reden anderer evangelischer Pfarrer die Infiltration der nationalen Mythen nachweisen, ja mehr als das, eine Religiosität, die nicht mehr durch den offiziellen Protestantismus gedeckt wird. Das Oszillieren zwischen Mythos, nationaler Religion und kirchlicher Lehraussagen ist ein zentrales Ergebnis, wenn man die evangelische Geistlichkeit betrachtet. Dies erscheint auch folgerichtig, weil in Potsdam die beiden Ebenen getrennt zelebriert wurden und in ihrer Gesamtheit erst die Durchschlagskraft der Herrschaftslegitimation auf religiöser Grundlage ausmachten. Besonders in der überkommenen Form der Feldgottesdienste zeigt sich die Verbindung von Nationalprotestantismus und religiöser Anknüpfung an die Mythen um die Preußenkönige.

In der Bezirkshauptstadt Minden nahmen am Feldgottesdienst auf dem Simeonsplatz neben der Reichswehr SA und SS sowie der Stahlhelm teil. Nach dem gemeinsamen Choral: „Großer Gott wir loben Dich“ folgte die Predigt des evangelischen Feldgeistlichen. Es sei die Zeit des „Frühlingserwachens“ und der „Märzstürme“ gekommen, die das bisherige Staatswesen — „ein armseliger, morscher Bau“ — zusammenbrechen ließen. Der Tag zeige den Sieg des „friderizianischen Geistes“ über den Geist von Weimar. Dann wird jedoch der Bezug zu Gott hergestellt, denn der Tag von Potsdam sei eine „Gnade aus Gottes Hand“ und die Erfüllung „unserer Gebete“. Es gelte auch zukünftig, den Neuaufbau zu leisten, für den man aber beständig beten müsse.
In der Garnisonsstadt Osnabrück, die man historisch getrost zum nichtpreußischen Westfalen zählen kann, fand der Feldgottesdienst eine halbe Stunde vor Beginn des Festaktes in der Garnisonkirche statt (Abb. 8). Stahlhelm, SA und Reichswehr hatten sich auf dem Ledenhof versammelt. Die Glocken der evangelischen Kirchen läuteten die Festlichkeit ein. Den Beginn markierte der Choral von Leuthen. Pastor Schmelzkopf kann in seiner Predigt den Eingriff Gottes in das weltliche Geschehen mit dem Psalm 77 belegen: „Gott, Dein Weg ist heilig — Du hast Dein Volk erlöst mit Macht“. Ein Sturm brause durchs Land, der jeden einzelnen erfasse. Einen ähnlichen einheitsstiftenden Sturm habe Deutschland am 21. März 1871 und bei Kriegsbeginn 1914 erlebt. Die völkische Theologie feiert bei Schmelzkopf fröhliche Urständ. Der Tag von Potsdam markiere einen gottgewollten neuen religiösen Aufbruch, „nun endlich ist‘s so weit, nach langer Irrfahrt auch ein Volk des Glaubens“. Das deutsche Volk sei deshalb herausgehoben, weil es seine Bindung nicht im Diesseits gefunden habe, sondern — im Gegensatz zu anderen Völkern — immer den Blick auch in „Gottes Ewigkeit“ geworfen habe. Es sei ein Volk gewesen, das seine Geschichte nicht allein als ein Stück des Weltgeschehens auffassen konnte, sondern als Ausdruck des „heiligen Willens seines Gottes“. Demzufolge kann Schmelzkopf nun die Zeit des Niederganges von 1918 bis 1933 mit neuem Sinn erfüllen: Es sei eine Zeit der Prüfungen gewesen, gleichzeitig aber auch ein Weg der „Reinigung“, der beschritten werden mußte, um zu einer besseren Zukunft zu gelangen. Das Ende der Leidenszeit zeige sich nun im „Aufbruch“ der Nation, der einhergehe mit der Einheit des Glaubens, denn: „gottlose Völker vergehen — gottgebundene Völker bestehen und werden leben“. Das Leid der Weimarer Republik bekommt hier einen höheren, Gott gewollten Sinn, der die jeder Religion eigene Frage nach dem Leiden in der Welt und der Stellung Gottes (Theodizee-Problematik) eine Antwort gibt. Schmelzkopf konnte auf diese Weise die Bahnen des Protestantismus verlassen und Bilder gebrauchen, die den Leidensweg Christi und seine Auferstehung in Beziehung zu den Geschehnissen in Potsdam setzten — deutlicher kann man die Nationalisierung der Religion nicht zum Ausdruck bringen. Christi Auferstehung bleibe ohne seine Leiden unverständlich, gleiches gelte für das deutsche Volk, deshalb: „Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, an Deines Volkes Auferstehen“. Auch das welfische Osnabrück blieb vom Ruhm Potsdams nicht verschont. Hindenburg habe in der Gruft für das „ganze einige Volk“ Dank abgestattet und seine „Ehrfurcht“ zum Ausdruck gebracht.
Für die Polizei und die aus SA, SS und Stahlhelm gebildeten Verbände der „Hilfspolizei“ Bielefelds fand in der Neustädter Kirche am Morgen des 21. März ein Gottesdienst statt. Der mit der Seelsorge der Beamten betraute Pfarrer Bonhoff sah den Tag als ein Bekenntnis dafür an, daß die durch die beiden Preußenkönige verkörperten „Energien“ die tragenden Kräfte einer neuen „Volksbewegung“ seien. Friedrich Wilhelm I. stehe für eine „männliche Glaubenshaltung“, sein Sohn für die „Pflichterfüllung‘“ und für den Aufstieg Preußens zur Großmacht. Nicht die Gestalten des Christentums wurden als Vorbilder präsentiert, wie es die Reformatoren trotz ihrer Ablehnung der Heiligenverehrung noch für möglich hielten, vielmehr Gestalten der preußischen Geschichte, die mit Eigenschaften versehen wurden, die ihr Weiterleben auch in der Gegenwart sicherten. Bonhoff verfiel wie Dibelius, Zoellner und Schmelzkopf der durch den Tag von Potsdam möglich gemachten neuen Deutung der Zwei-Reiche-Lehre Luthers und verknüpft diese mit der Volkstheologie: Die neue Regierung könne ihr Einigungswerk nur vollbringen, wenn religiöse Kräfte das ganze Volk beseelen würden.
Was sich in den offiziellen Gottesdiensten abzeichnete, nämlich die besondere Hinwendung Gottes zum deutschen Volk, wird auch in den Redebeiträgen evangelischer Pfarrer bei den abendlichen Kundgebungen deutlich.
Wie das Neue Testament die Heilstat Christi als Neuen Bund schildert, so sahen viele protestantische Pfarrer Westfalens, weitergehend als Dibelius, in ihren Predigten und Redebeiträgen einen weiteren Bund in der deutschen Geschichte, beginnend mit der Reformation Luthers, fortgeführt im Preußen Friedrich des Großen, weiterentwickelt im Deutschen Reich Bismarcks und dann, nach einer Zeit des Niederganges, nun wieder beginnend mit dem Tag von Potsdam. Pfarrer Wendland, lutherischer Pfarrer der Hagener Kirchengemeinde Haspe, sprach (besser: predigte) bei der abendlichen Feier in der Hagener Stadthalle als Vertreter der Kampffront schwarz-weiß-rot, der Organisation der DNVP, zum Thema: „Zeitenwende‘“[52]. Gott ist es, dessen Gnaden im März 1933 besonders intensiv zu spüren sind, so der Pfarrer. „Wir fühlen, daß eine unsichtbare Hand arbeitet, um wieder ein Blatt deutscher Geschichte umzuwenden.“ Warum ist das deutsche Volk so besonders eng mit Gott verbunden? Zunächst durch die Geschichte, denn in der Reformation Luthers und im Beginn des deutschen Reiches 1870, von Wendland als protestantisches Reich verstanden, zeige sich dies deutlich. Folgt man Wendland weiter, können Gedankengänge identifiziert werden, die sich von der lutherischen Rechtfertigungslehre unterscheiden. Ausgangspunkt ist für Wendland wiederum die Weimarer Republik als Zeit der Leiden, die es zu erklären galt: „Noch vor einigen Jahren wußten wir nicht, warum wir den Krieg verloren hatten. Es war eine scheinbare Sinnlosigkeit, heute kennen wir den Sinn: es ist das blutgeeinte deutsche Volk.“ So verstanden, sind die Toten des Weltkrieges und das Leiden in der Weimarer Republik das Opfer, um Gott wieder versöhnlich zu stimmen. Das Opfer, das das deutsche Volk gebracht hat, garantiert göttliche Wohltaten, so kann man die Worte des Hasper Pfarrers verstehen; zudem tauchen wie bei der Predigt Schmelzkopfs Bilder auf, die den Leidensweg Christi in Analogie stellen zum Blutopfer der Soldaten.
In der ostwestfälischen Kleinstadt Gütersloh, einem der Zentren der neupietistischen Erweckungsbewegung, sprach der Pastor der lutherischen Kirchengemeinde, Gronemeyer. Wie bei Wendland zeigt sich für den Gütersloher Geistlichen Gott bevorzugt in der deutschen Geschichte. Hervorstechendes Merkmal der Deutschen sei der Wunsch nach Einheit und Gläubigkeit, wie es sich beispielsweise in der Zeit des Krieges gegen Frankreich 1870/71 gezeigt habe. Gronemeyer bewegt sich wie die anderen Pastoren in der Grauzone zwischen kirchlicher Theologie und nationaler Religion. Die Herrschaft der Preußenkönige sei auf „Gottesfurcht und Glauben“ gegründet gewesen. Von daher fällt es Gronemeyer leicht, als zentralen Bestandteil der Feier in Potsdam die Kranzniederlegung Hindenburgs an den Gräber der Preußenkönige herauszuheben. In diesem Moment sei es den Güterslohern klar geworden, daß die Arbeit der neuen Regierung unter Gottes Schutz stehe: „Gott möge es lenken, denn er allein hat die Macht dazu“. Gronemeyer verweist dann auf den Handschlag zwischen Hindenburg und Hitler und erinnert an die Rede des letzteren: wenn seine Sympathien auch dem Reichspräsidenten gelten und er ihm eine besondere Stellung im heilsgeschichtlichen Werk zuweist, kann Gronemeyer nicht umhin, auch in den Worten Hitlers „den großen Ruf [Gottes, W. E.]“ zu fühlen. Damit hat auch der deutschnationale Pastor Gronemeyer über die Feier in Potsdam zu einem Hitler gefunden, der zum einen durch die überragende Person Hindenburgs und die mit ihm verbundenen preußischen Mythen religiös legitimiert wird, der zum anderen jedoch auch aus der Geschichtstheologie heraus zu einem von Gott Herausgehobenen wird. Damit verläuft die religiöse Legitimierung wieder in kirchlichen Bahnen, wofür auch die abschließenden Lieder sprechen: „ich hab‘ mich ergeben‘ und „Gott behüte unsere Lande, unsere Seelen vor der Schande, Gott erhalte Deutschland frei“.
Festzuhalten bleibt, daß die Kirche der Feier des Tages von Potsdam generell nicht ihren Stempel aufdrücken konnte. Dies ist nicht als Argument für fehlende Kirchlichkeit zu werten: Die Potsdamer Gottesdienste wurden im Rundfunk übertragen, am folgenden Tag in den Zeitungen beschrieben. Die Kirchengebäude traten durch Beflaggung und/oder Glockengeläut in Erscheinung. Auch boten sich den Teilnehmern in der evangelisch-westfälischen Provinz Bestandteile bei den Feierlichkeiten an, die sie im Kontext ihrer Kirchenerfahrung mit Kirchlichkeit gleichsetzen konnten. Laien kam die Funktion zu, die Geschehnisse in Potsdam in ihrem religiösen Sinngehalt zu deuten und den Beistand Gottes und/oder der heiligen Könige herabzuflehen. Es hat sich die lutherische Idee des allgemeinen Priestertums der Gläubigen durchgesetzt, doch entsprang der Anlaß nicht dem reformerischen Wollen der Amtskirche.
Laien als Prediger
Als Vertreter des deutschnationalen Lagers traten die Bürgermeister als Spitzen der Verwaltung, Schulleiter, Ärzte oder sonstige Vertreter des Bildungsbürgertums auf; dazu kamen die Redner der NSDAP. Zunächst lassen sich Parallelen zu den Reden und Predigten der Pfarrer aufzeigen: Der Tag von Potsdam war der Tag, an dem auch die Laien den göttlichen Eingriff in die Welt verspürten. Offensichtlich benötigten sie hierfür nicht die Interpretation aus berufenerem Munde, also seitens der Pfarrerschaft. Die Deutung des Tages als göttliches Wollen bekamen die Westfalen bereits am Morgen in der Zeitung zu lesen. Eine Hagenerin gibt im Westfälischen Tageblatt ihren Gefühlen Ausdruck: Der Tag sei „ein gewaltiges Beben, das Deutschland erzittern“ lasse. Die Zeit der Not, die Zeit von „Jammer und Pein“ seien vorbei, denn „Oh, Herr, mach uns frei!“. Die Anspielung auf das Niederländische Dankgebet wird fortgeführt, indem die Autorin an das nahe Gericht erinnert, doch nun habe das deutsche Volk seine Pflichten erkannt, Gott der „Allmächtige“ helfe nun, das Reich der Zukunft zu bauen, das „Heilige Deutschland“. Die Autorin verläßt sich nicht auf die kirchliche Lehre vom Vertrauen auf die göttliche Gnade, nein: die Deutschen hätten durch die Leidenszeit und durch ihre Tugenden die göttliche Hilfe auch verdient. Diese enge Verbindung von Werkfrömmigkeit und göttlichem Eingriff fand auch bei den Feiern ihren Ausdruck. Der Rektor der Herforder Mittelschule, Fischer, übernahm es, seine Sichtweise von Potsdam den Zuhörern zu verkünden: Die Reichstagseröffnung bedeute das Zeichen religiöser Erneuerung: „Wir müssen es wieder lernen, uns in Dankbarkeit vor der Majestät des Leiters des Weltgeschicks zu beugen“, Fischer nutzt die Metapher des Feuers: Heiliges Feuer und Freiheitsfeuer, in der deutschen Geschichte belegt, würden an diesem Tag das gesamte deutsche Volk verzehren, hier gelte es anzuknüpfen, denn alle Herforder sollten „Fackelträger‘“ an dem Neuaufbau Deutschlands werden. Dieses Feuer sei jedoch nicht allein menschliches Werk, es brenne zwar durch den Tag von Potsdam, doch sein Ursprung sei Gott. Fischer zieht das Pfingstereignis heran und interpretiert es als Form des göttlichen Beistandes, der automatisch-sakramental erwirkt werden kann: Gott gebe „das Feuer des Heiligen Geistes; das der allmächtige Gott denen verheißen hat, die ihn darum bitten!“
Ein anderer Schulleiter Herfords, der Direktor des Friedrichsgymnasiums; Dr. Deneke, hatte in Befolgung der Anweisung der preußischen Regierung Zeitgleich mit dem Ereignis in Potsdam eine Feier abhalten lassen. Die Schüler intonierten zu Beginn: „Ein’ feste Burg ist unser Gott“. Dem lutherischen Bekenntnislied folgte eine Verlesung aus dem Neuen Testament, hier aus der Offenbarung des Johannes. Der Schulleiter hatte sich das 21. Kapitel ausgesucht: „Siehe; ich mache alles neu!“ Die Wahl einer Passage aus der Apokalypse demonstriert nachhaltig, wie sehr der Schulleiter den Tag als den Beginn eines neuen Gottesreiches ansah. Diese Interpretation des Tages geht über die oben skizzierten Predigttexte hinaus, sie zeigt, daß sich religiös gesinnte Laien zwar noch von der Bibel leiten ließen, jedoch sich aus dem kirchlichen Kontext lösten. Hauptredner der Feier in Lünen war einer der Organisatoren, der Oberbürgermeister Schlegtendal. Auch sein Redebeitrag ist als Predigt außerhalb der Kirche zu werten: Er sah mit dem Tag von Potsdam einen Einigungsprozeß des Volkes im Entstehen, der gleichzeitig auch eine Rückkehr zum Christentum bedeute. Die neue Regierung sei der Garant für die Bekämpfung der Gottlosigkeit. Gestützt werde sie von Gott, der ein „mächtiger Gott“ sei, vor dem man sich nur verneigen könne. In Bad Oeynhausen endet der Bericht über die örtliche Feier mit den Worten: „Gott gebe es und lasse das große Erlebnis dieses wundersamen Abends zu einem Mark- und Grundstein einer neuen und zukunftsstarken Zeit werden.“
Was sich bei den protestantischen Predigern in Westfalen bereits abzeichnete, nämlich die Eigendynamik des Mythos Potsdam, wird in Zeitungen und in Redebeiträgen von Laien noch offensichtlicher. Der Leitartikler der Hagener Bergisch-Märkischen Zeitung verbindet Potsdam mit religiösen Gedanken. Die Zusammenkunft in der Garnisonkirche sei zum einen gottgebunden, denn in der Feier habe man sich vor dem „Ewigen“ gebeugt. Zum anderen kämen aber auch die Verbindungen mit der großen Vergangenheit zutage. Beides zusammen sieht der Autor als „Kraftquellen“, aus denen der preußische Staatsgedanke sich speise. Solange ein preußischer Staat vorhanden sei und auch seine Bewohner ihre Pflicht tun würden, solange sei der König unsterblich. Dies äußerte sich, folgt man dem Artikel weiter, in vielen Begegnungen der Garnisonkirche: erinnert wird an die Zusammenkunft von Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise mit dem Zar und an den Besuch von Napoleon. Die Gräber der beiden Könige nähren die „Hoffnung in unseren Herzen“, die „jung und stark“ bleibt. In Bünde rief der Sprecher des Stahlhelms: „Möge der Geist Friedrichs des Großen, …, auch unseren Reichstag beseelen und ihm zum Siege verhelfen.“ Danach wurde Friedrich der Große mit dem Choral von Leuthen beschworen.
Offensichtlich entsprechend zur Feier in der Garnisonkirche geriet Friedrich zu der Gestalt eines Heiligen, dem man eine besondere Kraft zutraute, Tief im Innersten waren die Redner davon überzeugt, daß er am 21. März seine Hilfe zur Verfügung stellen wird: Wilhelm Gräfer, Bürgermeister der lippischen Stadt Lemgo, sieht ein militärisches Bild. Der Tag von Potsdam sei derjenige Tag, an dem Reichsregierung und Reichstag in der Garnisonkirche zum „Appell“ am Sarge Friedrich des Großen angetreten seien. Dieser habe den „Befehl erteilt“, im „Geist des Preußentums den Wiederaufbau“ vorzunehmen. Was dem heutigen Leser vielleicht pathetisch vorkommt, spiegelt kollektive Mentalitäten breiter Schichten des nationalkonservativen Bürgertums wider, in denen sich historisches Wissen, mythisierende Darstellung, kirchliche Deutungen und persönliches religiöses Erlebnis, in langen Zeiträumen erfahren, nun in einem konkreten Augenblick und in ritueller Feier verdichteten. In den Wortbeitragen kam das außerordentliche religiöse Erlebnis zum Ausdruck: Wahrnehmung der Nähe Gottes und der „Realpräsenz“ Friedrich des Großen in einer Zeit der Bedrängnisse.
Die religiösen Gefühle schwappten auch auf die Akteure des Tages über: Wie schon 1932 am Beispiel Bielefelds erläutert, so war auch im März 1933 Hindenburg eine Person mit hoher kultischer Bedeutung. Hindenburg habe, als er die Gruft Friedrich des Großen besuchte, etwas von der „unendlichen Liebe zur Nation“ ausgedrückt, so die Deutung des Rektors Winter in Herford. Ein zweiter Name stand im Rampenlicht: Adolf Hitler. Er lebe zusammen mit Hindenburg den Herfordern vor, „sich in demütiger Ehrfurcht [zu] beugen vor den Heldentaten der deutschen Männer, des Staats- und Geisteslebens und der Arbeit“. Beide hatten sich in Potsdam „in stiller Ehrfurcht vor dem Leiter der Geschichte, dem himmlischen König“ gebeugt und seine Gnade erfleht. Ihnen komme deshalb der „heilige Geist“ zu. Ein anderes Bild benutzt der Bürgermeister von Bad Oeynhausen, Dr. Kranold, jedoch mit dem gleichen Ergebnis: der Sakralisierung des Herrschers. Ins Zentrum stellt er die Begegnung zwischen Hitler und Hindenburg. Der „greise“ Reichspräsident habe dem Reichskanzler in die Augen gesehen und ihm mit seinem Händedruck mehr gesagt, als „Worte auszudrücken vermögen“. Der Salbungscharakter dieses Handschlags wird von Dr. Kranold rezipiert als „Vereinigung“ dieser beiden Männer, die „lange Zeit vorher nicht möglich“ war — dies sei göttliches Wollen. Doch komme ein entscheidendes Verdienst Adolf Hitler zu, hier wird m. E. wiederum die Verpflichtung Gottes angesprochen, die menschlichen Leistungen und Entbehrungen zu belohnen: Der Reichskanzler sei „auf einem langen und dornenvollen Wege über die Eroberung der Herzen seiner Volksgenossen emporgestiegen, von vielen verkannt, … Mit zielbewußter Folgerichtigkeit ist er seinen Weg gegangen, …, dessen Ziel einzig und allein war: Deutschland.“ Nur er sei es, der Deutschlands Einigkeit herstellen könne und die Deutschen „hinaus führe“ aus der Not unserer Tage. Konsequent bezeichnet der Redner Hitler als „gottbegnadeten Führer“! Hitler mit seiner Passionsgeschichte wird zum Erlöser stilisiert.
In diesem Sinne äußerte sich auch der Lünener Bürgermeister. Hitler sei ein „heroischer Mann, der aus kleinen Anfängen die gewaltige Bewegung des Nationalsozialismus geschaffen hat. Er ist es, der uns mit Gottes Hilfe gerettet hat …. Gott schütze sein Leben und sein Werk!“ Der Oberbürgermeister Lünens greift dann, ohne daß er sich der Blasphemie bewußt wird, zu dem Bild des Einzuges in Jerusalem: „Ihm jauchzen wir entgegen“. Die Messiaserwartung konnte sich folglich verschiedener biblischer Erzählungen bedienen: in der Garnisonkirche war es die Taufe am Jordan und die alttestamentarische Salbung des Priesterkönigs, in der Provinz das Bild des Leidensweges und des Hosianna beim Einzug in Jerusalem.
Die zutiefst religiöse Ergriffenheit machte es auch möglich, daß verschiedene Redner versuchten, sich den neuen Machthabern anzudienen. Vorschnelle Interpretationen, hier allein von Opportunismus zu sprechen, sind verfehlt: In der Wahrnehmung der Betroffenen stellte sich der Tag von Potsdam als ein „Erweckungserlebnis“ heraus, das öffentlich verkündet werden mußte und dabei auch die individuelle Läuterung zur Sprache brachte. In Spenge tat dies der Bürgermeister Frentrup, in Lemgo der Bürgermeister Gräfer. Nachdem Wilhelm Gräfer zwölf Jahre lang an der Spitze der kommunalen Selbstverwaltung tätig gewesen war[53], konnte er nun ohne Gewissensbisse verkünden, er werde am Fackelzug in Lemgo teilnehmen. Die Bedenken einiger Bürger, er solle doch objektiv bleiben, habe er zurückgewiesen: „Ich pfeife auf die verfluchte Objektivität! Ich bekenne mich zu dem nationalen Deutschland.“ Er werfe jetzt alles hinter sich, um sich ganz dem neuen Staat zur Verfügung zu stellen.
Es wird ersichtlich, daß in der Mehrzahl die Feierlichkeiten nicht in kirchlichgebundene Bahnen zurückführten, sondern im religiös-nationalen Raum blieben, somit Entkirchlichung mit sich brachten, auch den Verlust des Heilsmonopols der Kirche implizierten. Die genaue Gewichtung bleibt schwierig, denn der regionale Widerhall der kirchlichen Gottesdienste in Potsdam ist kaum zu bestimmen.
Der Tag von Potsdam in seiner sozialintegrativen Bedeutung
Die Redebeiträge bildeten nur ein Teilelement der abendlichen Feier. Auch die anderen Bezüge lassen es zu, die Feierlichkeiten in evangelischen Orten Westfalens als religiöse Versammlungen zu identifizieren. Dabei bildeten an sich profane Elemente, außerkirchliche Frömmigkeit und kirchliche Versatzstücke eine untrennbare Einheit. Zunächst ist auf die religiöse Dimension des alle Feiern kennzeichnenden Fackelzugs hinzuweisen. Man erlebte im Zug durch den Ort das Gefühl von Gemeinsamkeit, verstärkt durch das Ziel, nämlich den Nachvollzug eines schon am Vormittag im Radio übertragenen und in den Medien groß angekündigten Ereignisses. Er ähnelt der Prozession, die ja religionsphänomenologisch gesprochen Heiligkeit in Bewegung setzt. Prozessionen enthalten heilige Requisiten und Rollen, hier sind es die den Abend erleuchtenden Fackeln, die Fahnen, sodann die Heraushebung bestimmter Personen. Zunächst ist hier an den Pfarrer zu denken. Die Pfarrer sind in Spenge, so Interviewpartner, an der Spitze des Zuges zusammen mit den Vertretern der NSDAP und den örtlichen Honoratioren marschiert. Wichtig auch die Teilnahme kirchlicher Gruppen. Dies konnte im dörflichen Bereich der Posaunenchor sein, der religiöses und militärisches Liedgut intonierte, so in Rödinghausen, Bünde, Spenge, Schalkmühlen im Märkischen. Auch Männer- und Jünglingsvereine wie in Spenge, die in der Tradition der Erweckungsbewegung stehende Vereinigung für entschiedenes Christentum in Elverdissen (Kreis Herford) oder kirchliche Gesangvereine wie in Lünen beteiligten sich. Auch Glockenläuten konnte einfließen, so in Hagedorn und Schalkmühlen.
In den Abschlußkundgebungen brachten, religionsphänomenologisch gesprochen, die Teilnehmer des Fackelzuges ihren gemeinsamen Gang als Opfer ein. Wenn auch diese Interpretation vielleicht zu weit geht, so können Fackelzug und anschließende Feierlichkeit in ihrem religiösen Sinngehalt nicht voneinander getrennt werden. Eingeleitet wurde die Feierlichkeit durchweg von kirchlichen Liedern: Der Posaunenchor, kirchliche Gesangvereine, aber auch Feuerwehrkapellen oder andere Musikgruppen spielten oder sangen Lieder wie „Lobe den Herren“, den Choral von Leuthen oder das Niederländische Dankgebet. Es folgten die Reden. Ähnlich dem kirchlichen Gottesdienst wurde beim Tag von Potsdam das Band zwischen Lebenden und Toten gefestigt: Auffallend ist nämlich, daß der Toten des Weltkrieges gedacht wurde. Die Einbeziehung der Toten schloß auch dorfbekannte Persönlichkeiten ein: In Rödinghausen erinnerte man sich etwa an den kürzlich verstorbenen Ökonomierat Meier. Ihm sei es nicht vergönnt gewesen, diesen Tag noch mitzuerleben. An zwei weiteren Punkten der abendlichen Feier wird der Totenkult deutlich: Mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes kam auch die neue Partei, die NSDAP, zu ihrem Recht: An den Märtyrer ihrer Bewegung, überhaupt an die Toten ihrer „Kampfzeit‘“, wird in den evangelischen Orten durchweg erinnert, hinzu trat an vielen Orten der Große Zapfenstreich.
Die Teilnehmer der abendlichen Feier stellten nicht nur Zuhörer wie bei der Potsdamer Übertragung; sie betätigten sich auch, und dies intensiver als in der evangelischen Kirche, wo man es bei Gesang und Gebet bewenden lassen mußte. In der abendlichen Feier des Tages von Potsdam gab es ausschließlich Akteure: Teilnehmer des Umzuges, Fahnenträger, Sänger, Jubelnde, Fackelträger und Mitorganisatoren. Die Ähnlichkeit mit den vielfältigen Rollen und Funktionen katholischer Laien im Rahmen des Prozessionswesens sind offensichtlich.
Die Parallele zu den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten katholischer Volksfrömmigkeit demonstriert auch des letzte Teilelement des rituellen Nachvollzugs des Potsdamer Ereignisses. Das Ende der abendlichen Veranstaltung bedeutete nämlich keinesfalls, daß die Teilnehmer nun voll der erhebenden Gefühle nach Hause gingen. Ganz im Gegenteil: Zwar nur in wenigen Zeitungen angedeutet, doch in der Festkultur fest verankert, war der Übergang in die Profanität. Was in Berlin das ausgelassene Feiern nach dem großen Fackelzug war[54], spielte sich in Westfalen in den dörflichen oder städtischen Gaststatten ab. In Lethmate im märkischen Industrierevier fand der Tag von Potsdam im Rahmen eines deutschen Abends statt „mit anschließendem gemütlichen Beisammensein“. Daß Geselligkeit und sakrale Weihe aufs engste zusammenhingen, gehörte auch zum Selbstverständnis der Lünener: „Naturgemäß fühlte jeder nationalgesinnte Bürger das Bedürfnis, dem Gefühl der Begeisterung auch im Kreise Gleichgesinnter Luft zu machen. Die Wirtschaften wurden angekurbelt wie noch nie.“ So klang der Tag von Potsdam in einem mehr oder weniger feuchtfröhlichen Abend aus, der die nachhaltige Wirkung — und hier nicht nur auf den nächsten Morgen beschränkt — nur noch erhöhen konnte. Erst jetzt erscheint es verständlich, welch tiefere Bedeutung kurze Notizen in den Zeitungen hatten: „Solch einen Tag hat Spenge noch nicht erlebt“; „eine Kundgebung, wie sie Groß-Aschen noch nie erlebt hat“. Das Westfälische Tageblatt kommt zu dem Schluß: „Die Feiern nahmen ausnahmslos einen erhebenden Verlauf und werden in der Erinnerung aller Teilnehmer unauslöschlich nachwirken“.
So ungewöhnlich es zunächst also klingen mag: aus dem gemeinsamen religiösen Handeln rührte eine sozialintegrative Bedeutung her. Die Feierlichkeiten schweißten somit die Koalition von Nationalsozialisten und nationalen Gruppen zusammen und legten die Grundlage für die von dem kollektiven Erlebnis ausgehende religiöse Legitimierung der Machthaber.
4. Die Feier im katholischen Westfalen
Die Rolle des Klerus
Ein Bestandteil der Feierlichkeiten in Potsdam war das feierliche Hochamt in der Sankt-Peter-und-Paul-Pfarrkirche. Hier deutete sich die vorsichtige Annäherung des Berliner Bischofs und des päpstlichen Nuntius gegenüber den neuen Machthabern an. Anders in Westfalen: Die generelle Zurückhaltung der katholischen Amtskirche wird an der Wahrnehmung der Ereignisse in Potsdam bereits deutlich: Der Paderborner Erzbischof Klein, der schon 1931 die Unvereinbarkeit von Kirche und Nationalsozialismus festgestellt hatte[55], äußerte gegenüber dem Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, dem Breslauer Kardinal Bertram, seine Bedenken über die Anwesenheit der NS-Abgeordneten in Uniform im Gottesdienst. Er befürchtete, daß dies „von den Nationalsozialisten in den einzelnen Diözesen reichlich ausgenützt“ werde[56]. Vertrat der Paderborner Erzbischof somit noch die ablehnende Linie des Hirtenbriefes vom 20. Februar 1933, so galt ebensolches auch für die Verantwortlichen in der zweiten westfälischen Bischofsstadt, Münster. Das dortige Domkapitel hatte am 21. März 1933 ‚Besseres‘ zu tun, als Gottesdienste für die neuen Machthaber zu zelebrieren: An diesem Tag kamen die Domkapitulare zusammen, um einen neuen Bischof zu wählen. Doch gab es auch erste Signale der Annäherung: Zwei Tage zuvor, am Sonntag, dem 19. März, dem Fest des Heiligen Josef (des Arbeiters), war Domvikar Rensing nach Herzfeld gereist, um vor den dortigen Kolpingbrüdern einen Vortrag mit dem Titel „Wir bauen mit!“ zu halten. Die Ziele der neuen Regierung, die gut seien, hätten die Kolpingsöhne schon lange erreichen wollen. Im einzelnen führte der Kleriker den Kampf gegen den Liberalismus, die Gottlosigkeit, den Marxismus an sowie die Hebung des Nationalbewußtseins und die Verchristlichung der Familie. Orientiert man sich am Westfalen des alten Reiches, so kann der Blick auf die dritte westfälische Bischofsstadt gerichtet werden: In Osnabrück beteiligte sich ein Vertreter der katholischen Geistlichkeit, der Domarchivar Dolsen, an der Feierlichkeit. Doch wird ein gewichtiger Unterschied zu den Predigten protestantischer Geistlicher deutlich: Er blieb eine Randfigur bei dem Feldgottesdienst der Reichswehr, einem Ereignis, das die Teilnahme katholischer Geistlicher aufgrund rechtlicher Verpflichtungen und lang geübter Praxis erforderte. Als Hauptakteur kirchlicherseits engagierte sich der evangelische Pastor Schmelzkopf. Auch an anderen Orten entzogen sich die katholischen Geistlichen dem seelsorglichen Auftrag für das Militär und für die Polizei nicht. So sind Andacht oder Meßopfer in den Kirchen oder die Beteiligung am Feldgottesdienst in den Garnisonsstädten und Standorten größerer Polizeieinheiten festzuhalten. Die Andachtstexte oder Predigten fielen im Vergleich zu denen der evangelischen Pfarrer ‚gemäßigt‘ aus: Es fehlen die nationalistischen Töne, es fehlt der Bezug auf die heiligen Gestalten Friedrichs des Großen und dessen Vater. Dies könnte in der leidvollen Erfahrung mit der preußischen Religionspolitik im 19. Jahrhundert begründet sein, dies könnte aber auch in einer anderen Sichtweise der Geschichte eine Erklärung finden, die sich katholisch-großdeutsch definierte und daher die preußisch-kleindeutsche Entwicklung nicht als die Geschichte eines ‚neuen Bundes‘ mit Gott verstehen konnte — Reformation und Reichsgründung waren negativ besetzt.
In den Gottesdiensten wurden Hitler und Hindenburg nicht explizit gewürdigt, wenn auch das Gebet für die neue Regierung nicht ausgespart blieb. Im Mittelpunkt der Predigten stand Christus, ethische Gebote des Christentums wurden aufgerufen, um sie für den neuen Staat nutzbar zu machen. Einige Beispiele: Im Gottesdienst für die Garnison in Minden erinnerte der katholische Dompropst an das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Katholiken 1914 erfaßt habe. In dieser Zeit habe sich die Liebe zum Vaterland geäußert. Dieses Gefühl rühre jedoch von Gott her, bei Ihm fänden die Menschen Halt, könnten sich erst dann erneut ihrer nationalen Verpflichtung widmen. In der Bielefelder Sankt-Jodokus-Kirche hielt der mit der Seelsorge für die Polizei betraute Pfarrer Schmidt die Festpredigt. Er knüpfte an eine Passage des Epheserbriefes an, nach der Christus im menschlichen Herzen wohne. Für die Katholiken bestehe die Pflicht, am Neuaufbau des Staates mitzuwirken. Es gebe jedoch nur ein Vorbild, um im rechten Glauben tätig zu sein: Christus, Dechant Ostermann hielt für die Hagener Schutzpolizei eine Andacht, in der er auf die enge Verbundenheit von Volk, Familie, christlicher Religion und Kirche hinwies. Der Bochumer Pfarrer Helmhardt sprach in einem Gottesdienst für die Schutzpolizei von einem wachsenden Glauben, der in das deutsche Volk eingezogen sei. Die Katholiken reklamierten folglich ihren Wunsch nach Integration in ein neues Staatswesen, wobei — hier sind die Parallelen zu den protestantischen Kirchen deutlich — dieses Deutschland auf christlicher Grundlage beruhen sollte. Das Motiv der Reevangelisierung scheint einen Aspekt auszumachen, der die Teilnahme erleichterte. Die Annäherung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Vorbehalte der Kleriker noch groß waren.
Konflikte zeigen, welche Widerstände Pfarrer gegen die Inanspruchnahme kirchlichen Heils entwickelten. In Castrop-Rauxel fand in der evangelischen Kirche ein Gottesdienst statt, an dem die SA, SS und der Stahlhelm geschlossen teilnahmen. Die Rote Erde, die NSDAP-Zeitung der Region, griff die katholische Geistlichkeit scharf an, da sie keine Meßfeier zelebrieren wollte. Pfarrer Funke, ein „Zentrumsmann“ in Menden im Sauerland, war zwar bereit, einen Gottesdienst abzuhalten, wollte jedoch uniformierte NSDAP-Formationen nicht zulassen. Die Partei habe sich an den „Bischof“ (wohl den von Paderborn) gewandt, um das Uniformverbot des Pfarrers aufzuheben. Mit Genugtuung stellt die Rote Erde fest, daß dies auch geschehen sei. Die Konfliktsituation in der Gemeinde zwischen Zentrum und NSDAP wird auch am weiteren Ablauf der Feierlichkeit deutlich: Das Heft des Handelns hatten nicht mehr die von der NSDAP verachteten „Zentrumsmänner“ inne, sondern der Ortsgruppenleiter. Auf Veranlassung seiner Partei marschierten die Schulen des Dorfes zur Wilhelmshöhe, wo die Feier ihren Fortgang nahm. Abends stand die Rede des NSDAP-Führers im Mittelpunkt. So konnte die Rote Erde voller Genugtuung den Pfarrer warnen. „Bald wird der Tag kommen, wo kein Gegner gegen das nationale Deutschland aufzustehen wagt!“ Die Mendener Auseinandersetzungen führen zu der Frage, ob die in Alleinregie der NSDAP durchgeführte Feierlichkeit wirklich der „gewaltige“ Fackelzug gewesen ist, wie es die Parteizeitung verkündet, und ob sich damit eine Spaltung der katholischen Laien abzeichnet, hier Befürworter des Festes und damit der neuen Regierung, dort die noch im katholischen Milieu verhafteten, auf Zentrumskurs befindlichen Gegner der Partei.
Das Verhalten der Laien
Die kontroversen Meinungen kirchlich gebundener Kreise können am Beispiel des Vereinswesens deutlich gemacht werden. Die Frage, ob man zusammen mit Stahlhelm, Kriegerverein und NSDAP als geschlossene Gruppe am Durchzug/Fackelzug und der abendlichen Feier teilnimmt, führte in den katholischen Orten Westfalens zu unterschiedlichen Antworten. Nicht nachzuweisen sind katholische Organisationen beim Tag von Potsdam beispielweise in Bocholt, Everswinkel, Herzfeld im Münsterland; Bad Lippspringe und Schloß Neuhaus im Paderborner Land; Hagen und Lethmate; Cloppenburg und Meppen im ehemaligen Niederstift Münster. Daß das Kolpingwesen als ein Bestandteil des katholischen Vereinswesens und des katholischen Milieus bedeutsam war und damit für die zum Teil nach wie vor existierende Geschlossenheit des katholischen Milieus spricht, wird am Beispiel von Lethmate deutlich. Am Sonntag, dem 19. März, dem Fest des Heiligen Josef des Arbeiters, hatten die Katholiken ihr Kolpinghaus eingeweiht, alle Vereine hatten sich eingefunden, ebenso die Geistlichkeit. Zwei Tage später fehlten diese Gruppen oder Personen beim Umzug. Wie schwer man im katholischen Vereinswesen um eine Beteiligung rang, wird am Beispiel Hagens deutlich. Der „Führerring‘ der katholischen Jugend Hagens entschuldigte sich in der dem Zentrum nahestehenden Westdeutschen Volkszeitung für die Abwesenheit beim 7ug von Potsdam, „Wir treiben keine Gesinnungsakrobatik, sondern wir bleiben uns selbst treu und den Tausenden katholischer Jugend in Hagen, die stets zu uns standen.“ Die Gewissenskonflikte, die dazu führten, an der nationalen Feier nicht teilzunehmen, bedeuteten jedoch keine Ablehnung der neuen Regierung gegenüber: „Ja, wir fühlen uns berufen, aus heißer Liebe zum deutschen Volke mit den Kräften, die aus unserer Religion entströmen, am Neubau von Staat und Gesellschaft mitzuwirken.“ Führt man sich die teilnehmenden Gruppen und die Rede des Pfarrers Wendlandt vor Augen, so kann man sich vorstellen, was den Katholiken aufstieß: die Sichtweise der deutschen Geschichte als Heilsgeschichte, die religiösen Züge, die dem Preußentum zugewiesen Wurden, und die erbitterte politische Feindschaft der nationalen Gruppen Hagens[57].
In anderen Orten weichte die geschlossene Front katholischer Laienorganisationen auf. Festzuhalten bleibt jedoch, daß nie das gesamte Vereinswesen marschierte. In Dülmen, im südlichen Münsterland, zog die Deutsche Jugendkraft mit, in Paderborn die Pfadfinder. In Delbrück waren es die Deutsche Jugendkraft, die Kolping-Söhne und die Jungmänner, die „ebenfalls nicht bei dieser vaterländischen Kundgebung fehlen wollten‘.
Das Fehlen kirchlicher Gottesdienste und die Spaltung innerhalb des kirchlichen Vereinswesens dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß insgesamt gesehen die Initiative von Goebbels auch in der katholischen Provinz von Erfolg gekrönt war. In fast allen Orten bedeutete der Tag von Potsdam ein Durchbrechen des vom Kirchenjahr geprägten Festkalenders. Der Klerus, die „Zentrumsmänner“ und die milieutreuen Katholiken gerieten zunehmend in die Isolation, als sie sich weigerten, diesen „Aufbruch“ mitzugestalten. Die katholischen Zeitungen sahen sich genötigt, einerseits die fehlende Begeisterung zu erklären, andererseits vorsichtige Zustimmung zu signalisieren. Das Eintreten der Katholiken für das „nationale Endziel“ ist eine „Herzenssache“, so der Münstersche Anzeiger. In Meppen bekundet der Leitartikler der zentrumsorientierten Ems-Zeitung die nationale Gesinnung des Ortes[58], doch gebe es in Meppen, der Stadt des berühmten katholischen Politikers Windthorst, eben keine „Konjunkturritter“. Sie, die Katholiken, kämen zwar spät, doch aus freien Stücken, um am nationalen „Endziele“ eines einigen Deutschlands mitzuwirken.
Auffallend, daß auch die katholischen Redner durchweg den Tag als göttlichen Fingerzeig wahrnahmen und daß sie in den beteiligten Akteuren verehrungswürdige Gestalten sahen, Interpretationen, die der Klerus nicht teilte. Der Redner in Everswinkel, Diplomingenieur Lohmann, ging von Gott als Urheber aus, denn dieser habe nach dem „Zwiespalt der vergangenen Jahre“ nun Männer in die Mitte des Volkes gestellt, die die Einigkeit schaffen wollten. Lohmann betete zum Himmel, „daß der Herrgott die Arbeit unserer Regierung segne“. Der Redakteur des Lippspringer Anzeiger stilisiert Hindenburg als Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft Deutschlands. Er habe nach dem „Bruderkrieg“ gegen Österreich das Kaiserreich miterlebt und dann die Zeit, in der alles „einzustürzen“ schien. Doch immer seien seine Augen in eine bessere Zukunft gerichtet, und diese sei jetzt eingetreten: „welch‘ eine Wendung!“[59] Der neue Kanzler komme aus dem Land, gegen das der Reichspräsident einst gekämpft habe. Der Oberbürgermeister von Bocholt bezeichnet Hindenburg als Garant für den Einigungsprozeß. Seine „erhabene unantastbare Gestalt steht fest in unseren‘ Herzen“. Einige Redner sprachen religiöse Bereiche an, die mit der katholischen Auffassung der Offenbarung nichts mehr gemein hatten. Diplomingenieur Lohmann fühlte wie die Laien im evangelischen Westfalen die besondere Bedeutung der Grabesstätte Potsdam. Die Feier sei „im Geiste Friedrichs des Großen [vonstatten gegangen], an dessen Grab der Feldmarshall von Hindenburg seine Referenz“ erwiesen habe. In Meppen unterstellte der Redner des Kriegervereins, Major a. D. Wesener, der neuen Regierung ein „Aufbauwerk im friderizianischen Geist“. In Rietberg verstand es der bereits in der Weimarer Republik tätige Bürgermeister Agethen, den Tag von Potsdam als Bekehrungserlebnis gegenüber dem neuen Staat zu gestalten — Ähnlichkeiten mit dem Lemgoer Bürgermeister werden deutlich. Er ehrte Hitler und Hindenburg als Heilige, denn an der Front des Rathauses wurden ihre Bilder angebracht, umgeben von einem Kranz „elektrischer Flammen‘.
Daß katholische Heilige jedoch für die Mehrzahl der Katholiken nach wie vor wichtiger waren als die beiden Preußenkönige, wird an den kirchlichen Feiertagen jener Zeit deutlich, in der der Tag von Potsdam stattgefunden hat: Auf das Fest des Heiligen Josef ist bereits verwiesen worden, sechs Tage später, am Samstag, dem 25. März, war das Fest Mariä Verkündigung, in den katholischen Zeitungen betont und in den Kirchen als Verweis auf den Beginn der Heilsgeschichte, das Weihnachtsfest, gefeiert[60]. Maria stand nach wie vor im Mittelpunkt katholischer Volksfrömmigkeit, sie trat ein für die Belange der Menschen im Diesseits und Jenseits, ihre Fürbitte wurde nicht angerufen, wenn es um die Belange der neuen Regierung ging.
Folgende Zwischenüberlegung kann angestellt werden: Die katholische Geistlichkeit Westfalens versagte der neuen Regierung ihre Unterstützung und verzichtete im Gegensatz zu den Klerikern in Potsdam darauf, göttliche Gnadenwirkungen sakramental zu stiften; ein Teil der katholischen Laien, insbesondere des katholischen Milieus, sah sich ebenfalls nicht in der Lage, der Feier des Tages von Potsdam beizuwohnen. Andere hingegen beteiligten sich, waren vom Wirken Gottes in der Geschichte ergriffen und glaubten auch an die Heilswirkungen des Wallfahrtsortes Potsdam. Um eine nähere Einschätzung zu erlangen, wie groß der Verlust kirchlicher Deutungsmacht einerseits und wie attraktiv andererseits die außerkirchliche Religiösität war, müßten Hinweise über die Beteiligung an den abendlichen Feiern gefunden werden. Hier ist den Zeitungsberichten natürlich wenig zu trauen, wenn der Erfolg der Feierlichkeiten herausgestellt wird. Das Fehlen kirchlicher Verbände ist ein erster Hinweis darauf, daß die Feierlichkeiten im katholischen Bereich nicht die Resonanz fanden, wie sie für den evangelischen Bereich herausgearbeitet wurde. Ein weiterer Beleg hierfür 1st Münster.
Zwar war die Stadt mit Flaggen geschmückt, auch hatten die protestantisch dominierte Universität, die Polizeischule und die Reichswehr entsprechende Feierlichkeiten veranstaltet, doch fehlte der ansonsten bekannte abendliche Fackelzug in der Stadt. Selbst die nationalen Verbände waren offensichtlich nicht in der Lage, eine entsprechende Feierlichkeit durchzuführen. Dem Schreiber des Münsterschen Anzeigers blieb nichts anderes als Schönfärberei: „50 kam es, daß auch in dem schwarzen Münster der Tag der nationalen Revolution einen Verlauf nahm, der dem in anderen Städten des deutschen Vaterlandes in nichts nachstand.‘“ In Paderborn wagten es die nationalkonservativen Kräfte nicht, bei der Feier federführend tätig zu werden. Von dem Lokal der NSDAP zog der Fackelzug zum Rathaus, einziger Redner war wie auch in Dülmen der Kreisleiter der Partei. Die katholische Zeitung stellt fest, daß „Hakenkreuzfahnen in Paderborn nicht zur Geltung kamen“. Dies wird auch aus Cloppenburg im Oldenburger Münsterland berichtet, der Region, in der 1936 der Kreuzkampf gegen die Nationalsozialisten stattfand. Dort wurde die Partei gar nicht miteinbezogen. Der Stahlhelm, der seit eh und je in diesem Hort des Katholizismus einen äußerst schwachen Stand hatte[61], und der Amtskriegerverband stellten mit einem Rechtsanwalt und einem Oberstudiendirektor die Redner. Was im evangelischen Bereich vor dem März 1933 mit dem Anwachsen der Deutschen Christen zu beobachten war und mit der Feier des Tages von Potsdam endgültig seinen Abschluß fand, gelang im Katholizismus folglich nur unvollkommen: Der Nationalsozialismus und seine Regierungsmitglieder hatten Schwierigkeiten, salonfähig zu werden. Doch konnten immerhin Elemente des Nationalsozialismus (Fahnen, Redebeiträge, Horst-Wessel-Lied) ihren Einzug in die katholischen Regionen halten, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie wir es für den Protestantismus beobachten konnten.
Unabhängig davon, daß die Beteiligung des Klerus und der Laien geringer war als im Protestantismus, wird sich im Episkopat unter dem Eindruck der außerkirchlichen Zelebration eines solchen Massenereignisses der Handlungsdruck verstärkt haben, den in Potsdam gegangenen Weg fortzusetzen, sonst hätte der Verlust des kirchlichen Deutungsmonopols gedroht. Hinzu kam, daß die Nationalsozialisten den Tag gezielt nutzten, um von den Bischöfen die Rücknahme ihrer Verurteilung der Nationalsozialisten zu verlangen. Die Rote Erde nahm beispielsweise die Ereignisse in Menden zum Anlaß zu hoffen, daß dieses Ereignis „in allen deutschen Gauen Schule macht und die Bischöfe ihren damaligen Erlaß einer gründlichen Revision unterziehen werden‘. Auf diese Weise geriet der Tag von Potsdam in der Provinz in all seinen Facetten zum Katalysator für die Fuldaer Erklärung vom 28. März.

Unmittelbare Nachwirkungen
Vielfältige Anknüpfungspunkte ergaben sich, um die religiösen Empfindungen wachzuhalten oder wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der Rundfunk verwandte ab dem 22. März 1933 das Glockenspiel der Garnisonkirche („Üb‘ immer Treu und Redlichkeit“) als Pausenzeichen. Nur wenige Tage später lief reichsweit im Kino ein Film mit Otto Gebühr an: Der Choral von Leuthen. Sinnfällig wurden also auch auf der filmischen Ebene die heiligmäße Gestalt des Königs und sein Schlachtenglück als Ausdruck der göttlichen Zuwendung dargestellt. Ideen des Tages von Potsdam fanden hier Wiederholung. Die Wochenschau berichtete ab dem 25, März ausführlich über das Treffen von Hitler und Hindenburg am Grabe Friedrichs des Großen (Abb. 9). Die bürgerlichen Zeitungen Westfalens schlachteten auch in den folgenden Tagen die Ereignisse mit den aus Berlin zur Verfügung’ gestellten Materialien und eigenen Korrespondentenberichten weidlich aus. Auch in den illustrierten Wochenblättern gedachte man des Tages. Die Zeitschrift des Hugenberg-Imperiums Die Woche stellte Friedrich den Großen vor der Garnisonkirche dar, heiliger Ort und der realpräsente Heilige wurden nochmals sinnfällig vor Augen geführt.

Postkarten und von den Nationalsozialisten in Umlauf gebrachte Plakate dienten ebenfalls als Gedächtnisstütze (Abb. 10). War diese Aufbereitung Ausdruck der vielfältigen Möglichkeiten, die das neue Propagandaministerium und die Rechtspresse geschickt einsetzten, so gab es darüber hinaus Impulse, die das Ereignis nicht vergessen ließen: Eine Kaffeerösterei beispielsweise schaltete am 23. März eine Anzeige, in der an die Gefühle und die Slogans des Tages verkaufsfördernd appelliert wurde: „Ein neuer Aufstieg erfordert Kraft durch Nerven. Alle Nervenkraft auf nützliche Arbeit konzentrieren, sie sonst aber schonen … — das ist das Gebot der Stunde. Darum Kaffee-Hag.“
Ein solches mediengestütztes Erlebnis mußte einen nachhaltigen Eindruck bei den Zeitgenossen hinterlassen. Ein Beispiel: Der reformierte Bekenntnispfarrer Voget aus Heiligenkirchen in Lippe blickte Silvester 1933 auf das vergangene Jahr zurück. In guter Erinnerung blieb ihm der „denkwürdige‘“ Frühlingsanfang, die Potsdamer Feier, sie ist neben anderen ein Anlaß, „Gott zu danken für Bewährung, Erhaltung und Förderung“[62]. Und noch 1941 beschrieb ein ehemals führender Vertreter der evangelischen Kirche, Otto Dibelius, die heilige Stätte, gab die ‚Mirakel‘ des Ortes zum besten und scheute sich auch nicht davor, trotz aller leidvollen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, den Tag von Potsdam als herausragendes Ereignis herauszustellen[63]. Auch Laien blieben ergriffen: Der aus Rhaden im Kreis Minden stammende Maler Karl Langhorst stellte im Sommer 1933 seiner Heimatgemeinde ein Gemälde zur Verfügung, das den Händedruck von Hitler und Hindenburg zeigte[64]. Dieses Treffen wurde von Langhorst als religiöse Weihe aufgefaßt, wie an der Kulisse Altar, Gruft und Predigtkanzel deutlich wird (Abb. 11).

Schlußbemerkungen
Die vorliegende Studie ließ sich von der Frage leiten, ob neben der politisch-institutionellen Geschichte des Tages von Potsdam auch eine religionsgeschichtliche Deutung möglich ist. Anhand der Stätte Potsdam, der Gestalten der beiden Könige, der rituellen Abläufe in Potsdam und in der Provinz sowie den Predigten und Reden der Beteiligten konnten kirchliche Deutungen und eine außerkirchliche Religiosität aufgezeigt werden. Sowohl die Feierlichkeit in ihrer Gesamtheit in Potsdam als auch ihr Nachvollzug in der Provinz zeichneten sich durch das Nebeneinander zweier Wege der Heilssuche und Heilsvergewisserung aus: Auf der einen Seite verkündeten Vertreter der evangelischen Kirche den Regierungswechsel als Ausdruck göttlichen Willens, als Eingriff Gottes in die Welt. Die Protestanten reklamierten die deutsche Geschichte seit der Reformation als Heilsgeschichte, der März 1933 war eine „Zeitenwende“, die einen erneuten Aufstieg des Reiches bedeutete, hin zu einem christlichen, evangelischen Reich. Von daher fühlten die evangelischen Pfarrer sich von der Last der pessimistischen Weltsicht Luthers, wie sie sich in der Zwei-Reiche-Lehre niederschlägt, befreit und konnten ihre Mitwirkung am Aufbau eines Reiches zusagen, in dem das Reich Gottes und das Reich der Welt in Einklang standen. Aus diesem Verständnis rührte die Konsequenz der Kirchenvertreter her, die Wundergaben ihrer Kirche bereitzustellen. In Predigten und Reden sprach das Evangelium, „aus dem dann Kraft und Wille des Guten von selber quillt“ (Ernst Troeltsch). Diese kirchliche Heilsspendung erzeugte Legitimitätsglauben, festigte die charismatische Herrschaft Hitlers, die hinfort eine religiöse Dimension enthielt.
Zurückhaltender agierte die katholische Kirche. In Potsdam zeichnete sich die vorsichtige Annäherung des Papstes, der Zentrumsfraktion und von Teilen der höheren Geistlichkeit ab, als für das Werk der neuen Regierung ein feierliches Hochamt gehalten wurde. Auch hierin äußerte sich die kirchliche Heilsspendung, nun nicht als Ausdruck der wunderstiftenden Kraft des Evangeliums, sondern als Ausdruck der Verfügungsgewalt der katholischen Kirche über den Gnadenschatz Christi, garantiert durch den regelgerechten Vollzug des Meßopfers. In der Provinz hingegen war die Präsenz der katholischen Kirche wesentlich geringer; demzufolge konnte die neue Regierung nicht so viel kirchliches Heil akkumulieren. Doch erhielt die nationalsozialistische Diktatur mit dem Agieren des Episkopats in der Folgezeit bis hin zum Konkordat vom 20.7.1933 und dem Auftreten des lokalen Klerus bei Maifeiern und Erntedankfesten auch von dieser Seite her die notwendige religiöse Legitimierung. Die partielle Verweigerung und die im Unterschied zum Protestantismus fehlende Wahrnehmung des Machtwechsels als heilsgeschichtliche Tat machten es jedoch der Amtskirche in der Folgezeit leichter, sich mitunter dem Regime zu versagen und nicht alle seine Maßnahmen durch gottesdienstliche Feiern religiös zu überhöhen. Dies kann besonders deutlich am Beispiel Westfalens aufgezeigt werden: Die Resistenz von Teilen des westfälischen Klerus und der Widerstand des Bischofs von Galen beruhten nicht zuletzt darauf, daß man den Machtantritt Hitlers nicht euphorisch begrüßt hatte und sein Regime nicht zum Anliegen des eucharistischen Opfers werden ließ.
Für die Protestanten stellte sich dieser Sachverhalt im Kirchenkampf anders dar: Sie sahen sich, so meine Hypothese, mit dem Dilemma konfrontiert, wie der verstärkte Druck der Nationalsozialisten auf die protestantischen Kirchen mit der „Zeitenwende‘“ des März 1933 vereinbar war. Hatte nicht Gott machtvoll in die Geschichte eingegriffen, um ein neues Reich auf den Weg Zu bringen? Wie konnte er dann die nachfolgenden Geschehnisse, die Zeit der Prüfungen und Leiden, wieder zulassen? Diese Theodizee-Problematik war letztlich für die protestantische Geistlichkeit nach ihrem Engagement im Umfeld des Tages von Potsdam kaum lösbar. So fanden sie sich trotz der herausragenden Barmer Erklärung von 1934 denn wieder im „Irrgarten“ (Johannes Heckel) und im Pessimismus der Zwei-Reiche-Lehre und verwahrten sich im Kirchenkampf nur dann gegen die Anmaßungen der neuen Machthaber, wenn es um Fragen des Bekenntnisses und der Rechtskirche ging. Römer 13 hatte wiederum die Oberhand gewonnen, man verhielt sich quietistisch.
Die Grundlegung des Hitlermythos (Ian Kershaw) auf religiöser Grundlage konnte jedoch nur dann langfristig Legitimitätsglauben erzeugen, wenn die Gläubigen den kirchlichen Feiern beiwohnten. Gebete und Gesang, Sakramentenempfang und Anwesenheit bei der Predigt machten erst die Wirksamkeit des Gottesdienstes aus, riefen, so die Wahrnehmung von Geistlichen und Gläubigen, göttliche Gnaden herab. Unzweifelhaft war die Beteiligung sowohl bei den kirchlichen Feierlichkeiten als auch bei den Fackelzügen, an denen evangelische Pfarrer als Redner teilnahmen, groß. Wenn auch Zahlenangaben nicht immer zu trauen ist, so imponieren Angaben wie 60 000 Teilnehmer in Hagen oder 5 000 bis 6 000 in Gütersloh. Auch Formulierungen wie die für die Gottesdienste der drei Konfessionen in Dortmund: „Die Kirchen konnten die großen Scharen der Gläubigen kaum fassen“ lassen die Nachfrage nach dem kirchlichen Heilsangebot für die neue Regierung deutlich werden.
Der Legitimitätsglaube speiste sich aus einer zweiten, nicht zu unterschätzenden Quelle: Die Feier in der Garnisonkirche und die Redebeiträge von Laien und selbst protestantischer Pfarrer ließen erkennen, in welch hohem Ausmaß Glaubensdeutungen vorhanden waren, die nichts mehr mit den anstaltlich normierten Lehren gemein hatten. Deutungen des Nationalprotestantismus hatten sich mit dem Mythos der preußisch-deutschen Geschichte und seiner heroischen Gestalten zu einer neuen Religion verdichtet, in der Gott zum deutschen Nationalgott geriet und Friedrich zu dessen auserwähltem Werkzeug. Manifest wurde diese Religion an dem Wallfahrtsort Potsdam mit seiner Gnadenstätte, der Garnisonkirche. In ihr waren die Gebeine Signal für die Anwesenheit der ansonsten transzendenten Gestalten auf Erden. Das „königliche Monument“ machte die unsichtbare Welt sinnlich erfahrbar. Friedrich der Große war in einer als Heilsgeschichte verstandenen Abfolge von Schlachten und staatlicher Geschehnisse herausgehoben und nahe bei Gott, zum anderen jedoch am Wallfahrtsort gegenwärtig, wo er aufgrund seiner Verdienste Gottes Hilfe auf die Mächtigen leitete. Dies zeigte sich im März 1933. Obwohl die kirchliche Lehre allen Agierenden bewußt war und sie die Präsenz der Könige sicherlich als Aberglauben verworfen hätten, stieg durch den rituellen Vollzug der Feier ein anderes religiöses Verständnis aus der Tiefe des Unbewußten auf. Diese Deutungen der Zeitgenossen machten den zweiten Bereich der Heilsstiftung möglich, doch außerhalb der kirchlichen Liturgie.
Dieser Strang der religiösen Begründung des Führermythos ist das Resultat einer Dialektik von Säkularisierung, die sich im Verlust des Sinndeutungs- und Heilsmonopols der Kirche abzeichnet, und der religiösen Aufladung nationaler Mythen. Doch stand diese rituell ausgedrückte Religion auf tönernen Füßen, wie sich in der Folgezeit erwies: Die Nationalsozialisten erhoben ihre Weltanschauung zur Religion. Demgegenüber besannen sich die Kirchen wieder auf ihre christlichen Gebote, die beim Tag von Potsdam vergessen schienen. Gleichwohl: dies geschah zu spät. Der Tag von Potsdam als kirchlich-religiöses Geschehen hatte bereits mit den Grundstein für Unrecht und Terror gelegt. Diesen Zusammenhang sah ein Schweizer Protestant, Leonhard Ragatz, in einem Kommentar unmittelbar im Anschluß an den Tag von Potsdam in prophetischer Weitsicht. Alles sei eine Lüge gewesen, „der Gipfel der Lüge, die Lüge, die religiöse Aufmachung dieses ganzen dämonischen Schwindels, dies Glockengeläute und Orgelspiel, diese Choräle, diese Gebete, diese Predigten — alles auf den Ton gestimmt: Gott ist mit uns! —, dies zuletzt eine schwere Lästerung. Denn abgesehen von all der Lüge — in dieses Glockenläuten, Orgelspielen, Singen, Beten, Predigen tönen die Schreie der … gemarterten Söhne und Töchter Deutschlands. Das ist diese Eröffnungsfeier in der Potsdamer Garnisonkirche …: Ein Gebäude aus Schein und Trug — gekrönt durch diesen religiösen Trug — das furchtbar zusammenstürzen wird, als Symbol des Sturzes all der Mächte, die sich darin zusammenfanden[65]. In der Nacht des 14. April 1945 zerstörten alliierte Bomber die Potsdamer Garnisonkirche, ihr Schatz war indes bereits in ein Bergwerk ausgelagert worden. Die Rückführung der Gebeine vor wenigen Wochen hat bei uns keine religiösen Gefühle mehr wachgerufen, das Medienspektakel ist vergangen, ohne nachhaltige Spuren zu hinterlassen.
Die Text erschien zuerst in: Westfälische Forschungen 41, 1991, S. 379-430.
Prof. Dr. Werner Freiatg war von 1996 – 2004 Professor für die Landesgeschichte Sachsen-Anhalt am Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle und von 2004 bis zu seiner Emeritung 2022 Professor für Westfälische und Vergleichende Landesgeschichte in Münster.
Anmerkungen
[1] Wesentlich erweiterte Fassung eines Vortrages anläßlich der Verleihung des „‚Karl-Zuhorn-Stipendiums zur Förderung der westfälischen Landesforschung‘“ des Landschaftsverbandes Westfalen- Lippe am 22. September 1991 in Lünen. Der Aufsatz fußt wesentlich auf Überlegungen und Materialien eines Grundkurses „Kirche und Herrschaft‘, den ich mit Thomas Sandkühler an der Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philosophie, Abteilung Geschichte, im Wintersemester ’90/91 und Sommersemester ’91 durchführte. Dem Kollegen Sandkühler kann an dieser Stelle gar nicht genug gedankt werden für seine Ideen, konzeptionellen Präzisierungen und Literaturanregungen. Auch den Teilnehmern des Grundkurses gebührt ein Dankeschön. Stellvertretend seien genannt: Simone Ameskamp, Philipp Koenen, Melanie Meyer zur Heide, Elke Potthoff, Remco Schaumann, Thorsten Schrumpf und Martin Vogt. Anregungen und Hilfestellungen gaben Winfried Heß, Lünen, Dietrich Korthals, Spenge, Bernard Korzus, Münster, und Norbert Schnitzler, Universität Bielefeld.
[2] Einschlägig: Karl-Dietrich Bracher: Stufen der Machtergreifung (Teil 1: Bracher/Schulz/Sauer: Die nationalsozialistische Machtergreifung: Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34), Frankfurt 1979, S. 202-213, bes. 212 f.; Joachim Fest: Hitler. Eine Biographie, Frankfurt 91977, S. 555-557; Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, Berlin 1989, S. 270-272. „Kein anderes Ereignis in den Anfängen des Regimes hat die Illusionen so gefördert wie der Tag von Potsdam. Der wilde Nationalsozialismus schien allen Erfahrungen der vergangenen Wochen zum Trotz doch in das Netz des traditionellen Konservativismus gegangen zu sein. Die Verbeugung Hitlers vor dem nationalen Mythos [!] Hindenburg erschien als Verbeugung einer jungen, dynamischen Bewegung vor der Tradition, auf deren Grundlage sie das Werk der Erneuerung und nationalen Einigung über den Klassen zu verwirklichen gedachte“ (ebd., S. 271).
[3] Bracher, Stufen, S. 209; Thamer, Verführung, S. 270.
[4] Ian Kershaw: Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980, S. 16.
[5] De historische Forschung läßt uns an diesem Punkte im Stich: Lediglich Brakelmann Jasper und Scholder gehen der Frage nach, wieweit die bei der Durchführung des Tages mitwirkende proteantische Kirche bestrebt war, eine Neubelebung der Allianz von Thron und Altar zu erzielen und in welchem Ausmaß sie den nationalsozialistischen Terror rechtfertigte. Vgl.: Günter Brakelmann: Hoffnung und Illusionen evangelischer Prediger zu Beginn des Dritten Reiches: gottesdienstliche Feiern aus politischen Anlässen, in: Detlef Peukert u. Jürgen Reulecke: Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 129-148, hier S. 141-46; Gotthard Jasper: Die gescheiterte Zähmung. Wege zur Machtergreifung Hitlers 1930-1934, Frankfurt 1986, S.173 f.: ausführlicher: Klaus Scholder: Die Kirchen und das Dritte Reich, Band 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918-1934, Frankfurt 1977, S. 324 f., 285 f.
[6] Zentral für das Verständnis von rituellen Handlungen im Kontext von Religion: Emile Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt 1981. Rituale sind „Verhaltensregeln, die dem Menschen vorschreiben, wie er sich den heiligen Dingen gegenüber zu benehmen hat“ (ebd., S. 67). Genutzt wurde weiterhin die Webersche Religionssoziologie in: Max Weber; Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 51980, S. 245-381, prägnante Definitionen ebd., S. 288, 307, 259.
[7] Ebd., S. 29, Ernst Troeltsch, Artikel: Kirche, III. Dogmatisch, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 3, Tübingen 1912, Spalte 1147-1155.
[8] Ebd., Spalte 1150 f.
[9] Reiner Küpper u. Thomas Sandkühler, Artikel: Säkularisierung/Modernisierung, in: Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Band 2, S. 163-170.
[10] Mythos ist die in Legenden, Erzählungen und Bildern manifest gewordene Erinnerung eines Volkes, die durch literarische Verfahren, zum Teil wissenschaftlich gestützt, zum Alltagswissen der Gesellschaft gehört. Vgl. Wulf Wülfing u. a.: Historische Mythologie der Deutschen 1798-1918, München 1991, 5. 2-5.
[11] Die folgenden Ausführungen beruhen auf: Robert Ostmann: Geschichte der Königlichen Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam, Potsdam 1862; Die Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam, hg. vom Gemeindekirchenrat, o.O, o.J. (1932); Die Potsdamer Hof- und Garnisonkirche seit dem 21. März 1933 die Geburtsstätte des Dritten Reiches, Anhang zu: ebd.; Artikel: Potsdam in: Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg, bearb. von R. Bergau, Berlin 1885, S. 570-581.
[12] Zentral: Otto Hintze: Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in Preußen, in: ders.: Regierung und Verwaltung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preußens, hg. von Gerhard Oestreich, Band 3, Göttingen 21967, S. 56-96.
[13] Peter Dinzelbacher: Die „Realpräsenz“ der Heiligen in ihren Reliquiaren und Gräbern nach mittelalterlichen Quellen, in ders. u. Dieter Bauer (Hg.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, Ostfildern 1990, S. 115-174.
[14] Vgl. zur Königin Luise von Preußen: Wülfing, Mythologie, S. 59-111.
[15] Besonders hinzuweisen ist auf die von 1842 bis in die ‘30er Jahre des 20. Jahrhunderts kontinuierlich aufgelegte Geschichte Friedrichs des Großen von Franz Kugler und Adolph Menzel. Vgl. hierzu: Peter Paret: Kunst als Geschichte. Kultur und Politik von Menzel bis Fontane, München 1990, S. 17-73. Einzelne Erzählungen finden sich auch in: Preußischer Choral. Deutscher Soldatenglaube in drei Jahrhunderten, Berlin 51940, S. 23-80, Freundlicher Hinweis Frank-Michael Kuhlemann.
[16] Ebd., S. 46-51. Das Deutungsmuster der Leuthener Schlacht war auch in späteren Zeiten nicht ungewöhnlich. Wilhelm I. kommentierte das Schlachtenglück bei Sedan als göttliche Hilfe: „Was für eine Wendung durch Gottes Fügung‘“. Auch dieser Ausspruch gehörte zum Bildungsgut der Zeit bis 1933.
[17] Ich danke Stefan Brakensiek für seine Hilfe bei der Beschaffung des Bilderbogens.
[18] Abbildung in: Hans Mommsen: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918 bis 1933, Frankfurt 1989, vor S. 377.
[19] Die Filme erreichten per Wanderkino selbst das kleinste Dorf. Vgl. expl. Stadtarchiv Spenge, A 461-463.
[20] Auch im Laienspiel der Theatergruppen nationaler Organisationen konnte die Gestalt Friedrichs lebendig bleiben. Vgl. ebd.
[21] Wolfgang Tilgner: Volk, Nation und Vaterland im protestantischen Denken zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus (ca. 1870-1933), in: Horst Zilleßen (Hg.): Volk — Nation — Vaterland. Der deutsche Protestantismus und der Nationalismus, Gütersloh 21970, S. 135-171.
[22] Karl Hammer: Der deutsche Protestantismus und der Erste Weltkrieg, in: Francia 2 (1974), S. 398-414.
[23] Karl-Wilhelm Dahm: Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen evangelischen Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933, Opladen 1965.
[24] Karl-Egon Lönne: Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt 1986, S. 217-247; Doris Kaufmann: Katholisches Milieu in Münster 1928-1933, S. 33-39, 54-62; Scholder, Kirchen, Band 1, S. 12-19.
[25] Die Analyse erfolgt nach Hans Hupfeld (Hg.): Reichstags-Eröffnungsfeier in Potsdam. Das Erlebnis des 21. März in Wort und Bild, Potsdam 1933; Hans Wendt: Die Nationalversammlung von Potsdam. Deutschlands große Tage 21.-23. März 1933, Berlin 1933 sowie den Berichten und Meldungen der Tageszeitungen. Die Zitate sind, soweit nicht anders vermerkt, dem Text von Hupfeld entnommen.
[26] Scholder, Kirchen, Band 1, S. 285.
[27] Bergau, Inventar, S. 579 f.
[28] Scholder, Kirchen, Band 1, S. 296. Vgl. zur Person: Robert Stupperich unter Mitarbeit von Martin Stupperich: Otto Dibelius. Ein evangelischer Bischof im Umbruch der Zeiten, Göttingen 1989.
[29] Vgl. zur Diskussion um die Zwei-Reiche-Lehre: Harald Diem: Luthers Lehre von den zwei Reichen — untersucht von seinem Verständnis der Bergpredigt aus. Ein Beitrag zum Problem: ‚Gesetz und Evangelium‘, in: Gerhard Sauter (Hg.): Zur Zwei-Reiche-Lehre Luthers, München 1973, $. 1-173; Johannes Heckel: Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre. Zwei Abhandlungen zum Reichs- und Kirchenbegriff Martin Luthers, München 1957.
[30] Von weltlicher Obrigkeit, wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523), in: Kurt Aland (Hg.): Martin Luther. Der Christ in der Welt (Werke, Band 7), Stuttgart 1967, S. 9-51.
[31] Rudolf Morsey: Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumspartei zwischen christlichem Selbstverständnis und ‚nationaler Erhebung‘ 1932/33, Stuttgart 1977, S. 128 f.
[32] Ludwig Volk: Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den Ansätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10, September 1933, Mainz 1972, S. 72; Bracher, Stufen, S. 210; Scholder, Kirchen, Band 1, S. 317 f.
[33] Waldemar Gurian: Der Kampf um die Kirche im Dritten Reich, Luzern 1936, S. 92.
[34] Zitiert nach den Tageszeitungen, hier Engerscher Anzeiger, 22. März 1933.
[35] Vgl. hierzu auch: Otto Meissner u. Harry Wilde: Die Machtergreifung. Ein Bericht über die Technik des nationalsozialistischen Staatsstreichs, Stuttgart 1958, Anm. 23, S.311.
[36] Elke Fröhlich (Hg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Sämtliche Fragmente, Teil 1: Aufzeichnungen 1924-1941, Band 2, 1.1.1931 bis 31.12.1936, München 1987, S. 396.
[37] Hier nach der Gedenkausgabe Leipzig 1936, S. 255.
[38] Scholder, Kirchen, Band 1, S. 299.
[39] Freundlicher Hinweis Rolf Westheider.
[40] Evangelische Kirche im Nationalsozialismus am Beispiel Bielefeld, Dokumentation einer Ausstellung, Bielefeld 1986, 5. 11 f.
[41] Kaiserhuldigung durch die Christlichen Posaunenchöre Minden-Ravensbergs bei der Einweihung des Porta-Denkmals am 18, Oktober 1896, 0.0. o.J., S. 12. Freundlicher Hinweis Roland Gießelmann.
[42] Horst Ulrich Fuhrmann: Jöllenbeck. Heimat im Wandel der Zeit, Bielefeld 1991, S. 379.
[43] Ein Beleg findet sich in Hans Büning: Volksfrömmigkeit oder Zeichen christlichen Glaubens. Religiöse Sitten und Gebräuche in Kirchhellen, 0.0. 1990 (Schriftenreihe des Vereins für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen 20/21), S. 200.
[44] Ein Beispiel ist der spätere Bischof Clemens August Graf von Galen mit seiner 1932 erschienenen Broschüre ‚Die Pest des Laizismus‘.
[45] Exemplarisch Werner Freitag: Spenge 1900-1950. Lebenswelten in einer ländlich-industriellen Dorfgesellschaft, S. 72-78, 262 f.
[46] Bielefeld, Kirche, S. 27 f.
[47] Soweit nicht anders vermerkt, beruhen die Ausführungen zum Tag von Potsdam in Westfalen auf der Durchsicht folgender Tageszeitungen: Bielefeld: Westfälische Zeitung v. 22.3.1933, Westfälische Neueste Nachrichten v. 22.3.; Dülmen: Bulderner Zeitung vom 22., 23.3.; Bünde: Bünder Generalanzeiger vom 22.3.; Cloppenburg: Münsterländische Tageszeitung v. 22.3.; Bad Lippspringe, Paderborn, Neuhaus, Delbrück: Lippspringer Anzeiger v. 22.-25.3.: Bad Oeynhausen: Bad Oeynhausener Anzeiger v. 22.3.; Bad Salzuflen: Lippische Landeszeitung vom 23.3.; Bocholt: Bocholter Zeitung vom 22.3.; Herford, Elverdissen, Rödinghausen, Wallenbrück, Kirchlengern: Herforder Zeitung v. 22.3., Herforder Kreisblatt v. 21.-25.3.; Lemgo: Lippische Post v. 22.3.; Meppen: Katholisches Volksblatt (Emszeitung) v. 22.3.; Osnabrück: Osnabrücker Tageblatt v. 22.3.; Lünen: Lünener Tageblatt v. 20.-22.3.; Münster: Münsterscher Anzeiger v. 22.3.; Minden, Porta Westfalica: Mindener Tageblait v. 22.3.; Everswinkel, Gütersloh, Rietberg, Herzfeld: Die Glocke v. 22.3.; Gütersloh: Westfälische Zeitung v. 22.3.; Spenge, Stift Quernheim, Rödinghausen: Engerscher Anzeiger v. 22.3.; Dortmund, Wanne-Eickel, Menden, Castrop-Rauxel, Mengede: Rote Erde v, 21.-23.3.; Hagen: Bergisch-Märkische Zeitung v. 21.-22.3., Hagener Zeitung v. 22.3.; Hagen, Lethmate, Meggen: Hasper Zeitung v, 22., 25.3.; Hagen, Lethmate, Schwelm: Westdeutsche Volkszeitung v. 10.3.,21.-25,3.
[48] Neben den behördlichen Anweisungen in den Zeitungen der Provinz Westfalen ist hinzuweisen auf Reinhard Wulfmeyer: Lippe 1933, Die faschistische Machtergreifung in einem deutschen Kleinstaat, Bielefeld 1987, S. 75 f.
[49] Vgl. Freitag, Spenge, S. 393 f.
[50] Wolfgang Günter u. Dr. Bernd Hey, Archiv des Landeskirchenamtes Bielefeld, bin ich für Hilfestellungen dankbar.
[51] Der in Düsseldorf gehaltene Vortrag, betitelt ‚Die Bedeutung der Reformation für das‘ deutsche Volkstum‘, findet sich in: Wilhelm Zoellner: Die Kirche der Geschichte und die Kirche des Glaubens. Beiträge zum Neubau der Kirche, Berlin 1933, S. 84-101. Vgl. auch Werner Philips: Wilhelm Zeollner — Mann der Kirche in Kaiserreich, Republik und Drittem Reich, Bielefeld 1985, S. 114-118.
[52] Vgl. zur Person Wendlands Dirk Bockermann: Die Anfänge des evangelischen Kirchenkampfes in Hagen 1932-1935, Bielefeld 1988, S. 31-36.
[53] Vgl. hierzu Arnd Bauerkämper u. a.: Zur Stellung des Bürgermeisters im nationalsozialistischen Staat. Wilhelm Gräfer in Lemgo. Eine Fallstudie, in: Lippische Mitteilungen 51 (1982), S. 211 -239
[54] Anschaulich: Goebbels, Tagebücher, Teil 1, Band 2, S. 396.
[55] Scholder, Kirchen, Band 1, S. 169.
[56] Volk, Reichskonkordat, S. 72.
[57] Westdeutsche Volkszeitung vom 10. März 1933.
[58] Vgl. auch Wilfried Hinrichs: Die Emsländische Presse unter dem Hakenkreuz. Selbstanpassung und Resistenz im katholischen Milieu, in: Emsland/Bentheim, Beiträge zur Geschichte, Band 6; Sögel 1990, S. 7-253, hier S. 101 f.
[59] Vgl. Anm. 16.
[60] Westfälische Volkszeitung, Lippspringer Anzeiger v. 25.3.1933.
[61] Vgl. Joachim Kuropka: Schlageter und das Oldenburger Münsterland 1932/1933, in: Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1984, S. 85-98.
[62] Zitiert nach Volker Wehrmann (Bearb.): Lippe im Dritten Reich. Die Erziehung zum Nationalsozialismus, Eine Dokumentation 1933-1939, Detmold 1984, S. 278.
[63] Otto Dibelius: Vom Erbe der Väter, Berlin 1941, S. 105 f. Das Buch des ehemaligen Generalsuperintendenten war auch in Westfalen verbreitet. Ich danke Hern Dietrich Korthals für die Überlassung des Buches, das seine Eltern anläßlich ihrer Silberhochzeit von einem Pfarrer der ‚Bekennenden Kirche‘ als Geschenk erhielten.
[64] Marianne Nordsiek: Fackelzüge überall. Das Jahr 1933 in den Kreisen Minden und Lübbecke, Bielefeld 1983, S. 53.
[65] Zitiert nach Scholder, Kirchen, Band 1, S. 325.
Einen Kommentar verfassen: